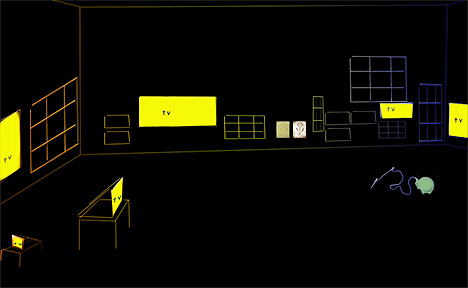Der Büchergutschein des letzten Jahreswechsels konnte leicht durchs ganze Jahr gehortet werden, weil die Philosophie untätig erscheint und die Soziologie sich aus dem ungemütlichen öffentlichen Raum zurückgezogen hat. Ein Gespräch mit Uwe Tellkamp am Radio vor zwei Wochen über sein Opus Magnum „Der Turm“, das soeben mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden ist, erweckte den Eindruck, einen Autoren kennengelernt zu haben, mit dessen Werk sich auseinanderzusetzen einen vielleicht aus der Lektüreabstinenz, die beim sommerlichen Konsum der Bildermassen nicht zu beunruhigen brauchte, herauslocken könnte. Neben dem tausendseitigen Turm, der zurzeit die Lieraturliste(n) anführt, wurde gleichzeitig der Romanvorgänger „Der Eisvogel“ (2005) angeschafft, weil der unverhütbare Blick ins Internet über dieses Werk mehr Seitenhiebe als Schmeicheleinheiten zutage förderte, was der Neugierde bekanntlich nur noch mehr Feuer gibt.
Und in der Tat liest man nun von Uwe Tellkamp zwei Werke, die nicht unterschiedlicher zu bewerten wären. Der Eisvogel, über dessen Titelsymbolik kaum Nachvollziehbares verlautet wird (45, 78ff, 186), ist nichts weniger als eines derjenigen Produkte, gegen die sowohl in diesem Roman wie auch im Turm und nicht zuletzt in Tellkamps Interviews voller Kraft angeredet wird: die Vorlage eines Stückes ziemlich seichter Fernsehunterhaltung. Die erste Zumutung ist der Hauptdarsteller. Vielleicht war dem Autoren einmal zu Ohren gekommen, dass es Leute mit einem Philosophieabschluss eher schwer haben, eine Lohnarbeit zu finden, sind sie erst einmal aus dem Universitätsbetrieb herausgespült. Flugs leistet er sich die Unterstellung, ein solcher Mensch verkomme moralisch im Ressentiment und sei bald schon zum Letzten bereit, zur Aufgabe des verantwortungsvollen Denkens zugunsten einer Gier nach Mitgliedschaft in saudummen reaktionären Gesellschaftszirkeln. Ob sich Tellkamp darüber wundert, dass sich ein paar RezensentInnen auf die Zehen getreten fühlen und ihm das auch zu verstehen geben wollen? Die Beschreibung der Beschaffenheit einer solchen Clique – von der immerhin stimmt, dass sie sozial unendlich in die Breite gehend begriffen werden müsste, bis in die unmittelbare Nachbarschaft des gesellschaftlich Anerkannten hinein – ist die zweite substantielle Zumutung. Man wünschte sich Tellkamp einmal über soziologische Texte gebeugt. Die Sprechweise des Terroristenführers und dessen Schwester, in die sich der Protagonist verliebt, sowie der Professoren (natürlich ist auch sein Philosophiechef darunter, der ihn vor die Türe stellte, weil er zu antiaufklärerisch argumentieren würde), Politiker und Kirchenvertreter in diesem Verschwörungstroupeau ist so hohl und idiotisch, dass man davon ausgehen muss, der Autor tappte täppisch in dickstem Nebel, wenn er sich eine Gesellschaft und die Abläufe in ihr vorzustellen habe. Dass bei den Beschwörungen der grossen Kultur nur Bach und Mozart den Kopf herhalten müssen, ist eine ungewollte Beleidigung auch der primitivsten Radio- oder Fernsehstationen, weil sie doch alles von Monteverdi bis Strauss in ihre Sauce unterzuziehen imstande sind und infolgedessen das niedere Publikum heute über sämtliche Passagen der Musikgeschichte orientiert wäre und dieselben unverblümt vom konservativen Kulturverständnis angerufen werden können. Das Namedropping mit Bach und Mozart ist lächerliches Fernsehkabarett, wenn doch Vivaldi, Beethoven, Schumann, Weber und Brahms kulturell dieselbe Funktion erfüllen. (Wie wundersam das Missverständnis einen doch immer noch aus der Bahn werfen kann, in dem Plebejer meinen, erst dann auf dem Feld der Kultur zu debattieren, wenn sie einige Heroen und Stücke aus ihr besonders werbewirksam hervorheben. Tellkamp hätte dann sein Ziel erreicht, wenn eine Figur des Romans über ein spezifisches musikalisches Problem irgendeines Werks aus der Musikgeschichte ernsthaft gesprochen hätte, das ihn selbst interessiert; mit dem Vorschieben der Müllmänner Bach und Mozart gibt er sich die Blösse, nur in der Kulturindustrie zuhause zu sein und von den ernsthaften Gebilden der Kultur, die es tatsächlich zu verteidigen gilt, keine Ahnung zu haben.) Zu diesen Ärgernissen gehören noch die romaninternen Zeitverläufe, die beim besten Willen nicht durchwegs auf die Reihe zu bringen sind: Personen besprechen Vertrauliches, auch wenn sie einander noch gar nicht vertraut sein können. Vom Schlechten der Gehalte bleibt indes die Form verschont, in der überzeugend der agierende Exphilosoph nach seiner Totschiessung des Terroristenführers und nach erlittenen schweren Brandwunden im Spitalbett das ganze Geschehen mit dem Vorlauf auch der Kindheit für den Gerichtsprozess in ein Gerät diktiert, stückweise unterbrochen durch die direkte Rede anderer Mitbeteiligter; es entsteht dadurch ein Gedankengewebe, das plausibel das beschädigte Bewusstsein eines Spitalpatienten entfaltet, das zwar nicht wenig vernebelt vorwärts- und rückwärts manövriert, formal aber doch sehr einleuchtend einen Einblick darin gewährt, wie so etwas Verquastes überhaupt hat zustandekommen können. Formal, in keiner Weise inhaltlich. Denn die letzte Zumutung macht das Unternehmen vollends zum bösen Fall: dass der Autor nicht zu erkennen gibt, ob es sich beim Verein nun wirklich um ein real sich vorzustellendes rechtsradikales Gebilde handelt oder um eine billige Theaterposse – und wie er selbst sich dazu verhalte. Der Autor wäre gut beraten, die Dialoge neu zu setzen und sämtliche Signale auszublenden, die zeigen, dass das Personal des Eisvogels zwar konservativ und radikal antidemokratisch denkt, keineswegs aber als faschistisch zu denunzieren wäre. Eine Belastung durch diese schmierige Lüge, als wäre rechts der herrschenden Rechten anderes als der Faschismus ausdenkbar, kann er sich als Künstler nicht leisten – nicht weil wir so argwöhnisch wären und ihm auf längere Zeit hin solches unterstellen wollten, sondern weil ihn die real existierende Rechte nur umso leichter in den Sack stecken würde. Es gehört wohl zu seinem Glück, dass die erste Verfilmung des Eisvogels nicht vom Fernsehen geleistet wurde, sondern von Jungspunden, die auf YouTube eine überzeugende Interpretation deponieren, die man nicht weiter zu überbieten braucht.
Nichts zu überarbeiten gibt es im Turm. Stilistisch ist dieses grosse Werk unspektakulär, weil geradlinig und in einfacher, zuweilen banaler Sprache beschrieben wird. Die Literatur leidet nicht an der Empfindlichkeit der Musik, in der eine Ästhetik schnell einmal zusammenbricht, wenn sie den Zusammenhang des intendierten Gehalts unterbricht, weil der sich nicht von einem festgelegten Stand des historisch geprägten Materials abgelöst gestalten lässt. In ungebrochener Weise wird die Lektüre zu erkenntnisreichen Einblicken und Einsichten in die Denk- und Verhaltensweisen einer Gesellschaftsschicht in Dresden ein paar Jahre vor bis knapp zum Mauerfall 1989 hingeführt, die sowohl mit der Kunst, der Medizin, den Natur- wie peripher auch mit den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften, gewollt und ungewollt aber auch mit der Machtausübung direkt verbandelt ist. Ich spreche aus der Warte eines Schweizers, einer Art des Tellenkämpens, die sprachlich nur wenig von der DDR entfernt ihr Leben führte, doch ohne Fernseher und ansässige Verwandte nur wenige Möglichkeiten hatte, sich mit dieser Gesellschaft auseinanderzusetzen, zumal das fehlende Kulturabkommen Reisen erschwerte und Studienaufenthalte verunmöglichte, wenn sie nicht dem Verfolgen einer Einzelfrage galten, meist im Bereich der Germanistik. Falls denn je ein Interesse mehr als eine Laune überdauerte, verschwand die DDR als Gesellschaft wie alle Länder des politischen Ostens im Dunst von Lebensweisen geführt in einer grauen Schuhschachtel aneinander vorbei, aus der nur die Nachrichten über Dissidentenschicksale Informationsgehalte freisetzten, die dann allerdings auch theoretische Diskussionen zu streifen vermochten. Ein Bild der Gesellschaft, in dem der Existenz der Einzelnen hätte Rechnung getragen werden können, ergab sich nie. Nichts weniger als dieses Gemälde präsentiert nun Tellkamp, und zumal Walliserprobte fühlen sich hier schnell wie zuhause, da sie auf Schritt und Tritt ihren bewunderten Suonen zu folgen meinen, ihren Wasserleiten mit den nunmehrigen Dresdener Namen Wolfsleite, Weinleite, Holländische Leite, Mondleite, Plattleite, Rissleite etc.; aber auch ein Mülti erscheint (736), ja sogar eine Viper, wenigstens dem Namen nach. Wenn schliesslich im Umland Dresdens die Kartoffeln als Apern verspiesen werden (438), bekommt man hierzulande Appetit auf Häpere. Das sind nur Spielereien, und eine Rezension könnte sie leicht nur deswegen in den Vordergrund schieben, um darunter dem Ganzen den Boden desto leichter wegzuziehen. Nein. Dass solche Äusserlichkeiten im Gedächtnis bleiben, zeugt gerade von der Tragfähigkeit des Ganzen, in dem sie überhaupt bemerkt werden. Die Fülle der Einzeldinge, die auch dann mit Sorgfalt zur Sprache kommen, wenn sie keine dramatische Funktion erleiden müssen, ruht in einem komplexen Ganzen, das nicht konstruiert ist, sondern in seiner Lebendigkeit vom Autor peu à peu erkundet wird. Noch ausserhalb des Romanwerks, auf der inneren doppelten Umschlagsseite, zeigt eine Skizze die Hauptplätze des Geschehens in den drei Teilen a) Quartier der Turmstrasse weit entfernt im Osten des Stadtzentrums, östlich davon b) die Elbe mit ihren Bauten in Ufernähe und ein paar Brücken und noch weiter östlich c) Ostrom als eine die amerikanische Gegenwart vorwegnehmende Secure City der Nomenklatura nicht ohne ein paar Sonderplätzen des Romans, die entschieden ausserhalb Dresdens liegen, wenn denn, wie das höllische Samarkand, überhaupt irgendwo. Ein Blick über Google’s Schulter zeigt schnell, dass hier nicht alles wie vom Zeichner angegeben im Massstab 1:1001 genommen werden darf, zumal er die Frechheit besitzt, die Nordrichtung festzuschreiben. Soll die Drahtseilbahn (neben welcher ganz in der Nähe noch eine Schwebebahn existiert) richtig positioniert werden, muss Tellkamps Skizze um 110° westwärts gedreht werden, wodurch die Elbe im Norden des Quartiers statt im Süden zu fliessen käme. Die Signale sehen wir klar: die Elemente des Vorgeführten entstammen der Wirklichkeit, ihr konkreter Zusammenhang ist in künstlerischer Freiheit konstruiert, nicht zuletzt daraufhin, damit die Mentalitäten in ihrer Brüchigkeit lebendig und eben nicht konstruiert erscheinen können. Aus der geografischen Distanz lassen sich einige Dinge nicht auf ihre empirischen Entsprechungen hin überprüfen, ob es zum Beispiel in der Tat Wohnquartiere wie Ostrom gegeben hat, die militärisch abgeschlossen nur dank zeitlich beschränkter Aufenthaltsscheinen und ständigem Passwortabfragen besucht werden durften; einige indes leichter gerade aus der Ferne. Das örtliche Zentrum des Romans ist die Turmstrasse, um die herum gruppiert die verschiedenen Akteure wohnen, nie einzeln in einem Haus, sondern mehrere Familien, Paare und Singles zusammengesperrt in den alten Villen, die mehr als Bruchbuden erscheinen denn als Objekte des sozialen Prestiges (als welche sie nichtsdestotrotz in Wirklichkeit galten). Legt man die gedrehte Skizze über einen publizierten Plan Dresdens und folgt der Turmstrasse, verbirgt sich in Tat und Wahrheit dahinter die Plattleite. Plattleite? Tellkamps Verrätselung ist leicht auf die Schliche zu kommen: Hinter den Leuten vom Turm stehen die von der Platte, die Blatters in allen ihren Formen, als die Aufdenplatten oder, man ahnt es doch endlich, die Supersaxo als die Höchsten und zugleich Dunkelsten des Wallis, die ihr Spiel hier treiben in Sachsens Dresden, und bekennt nicht einer der drei Protagonisten mehrmals, sich in der Schweiz am wohlsten zu fühlen, der Sächsischen? Ist man sich erst einmal über das Spiel mit der Materialität im klaren, kann man sich ganz den Triebkräften der Handlungen, Widerstreite und Reflexionen hingeben, wie sie im Verlauf dieser Jahre sich teils unterschiedlich, teils auf ein einziges Ziel hin, dass der graue Staat der DDR sich so radikal wie irgend denkbar ändere, entfalten. Und das ist die bewundernswürdige Leistung Tellkamps: dass man den Dingen ohne Widerstreben folgen will und die ganze Dynamik Dresdens dieser Jahre in extenso als glaubhaft erfährt. Doch trotz der durchgängig äusserst beeindruckenden und spannenden Lektüre sollen wenigstens zwei Punkte kritisch erwähnt werden, von denen der zweite gegenüber Tellkamp nun schon zum zweitenmal vorgetragen wird. Das Autoritäre der heutigen Gesellschaften zeigt sich unter anderem in der Allgegenwart des Militärs. Diesbezüglich geschieht eine grosse Partie des Turms zunächst in einem paramilitärischen Ferienlager des jungen Hauptakteurs, dann während seiner wegen eines Ausrufs in ungünstigem Moment durch eine ungemein brutale Strafe auf vier Jahre ausgedehnten Militärdienstes. Wer in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Militärkaserne aufgewachsen ist, braucht keine Soziologie, um zu verstehen, wie das träge Bewusstsein über den Tisch gezogen wird. Nur zu schnell ist einer, der beim Ausblick aus der Wohnstube zusieht, wie die militärischen Frischlinge sich unfähig gebärden, wenn sie einen Purzelbaum oder eine Rolle zu schlagen haben, zum einverständigen Murmeln bereit, wenigstens dazu sei der Militärdienst ja zu gebrauchen. Erst spät, da man schon an des Autors Haltung gegenüber dem Militärischen zu zweifeln beginnt, kippt die Szenerie ins Gespenstische, als die ungerechtfertigte, ewig dauernde Strafe den Dienst ausschliesslich als Hölle zeigt. Die zweite Kritik zielt nicht auf die Gehalte oder ideologischen Haltungen, sondern auf die Ästhetik, und sie läuft nicht so leicht ins Leere wie die erste. Ob aus falscher Scham vor der Allmächtigkeit der Kulturindustrie oder aus Mangel an Wissen, lässt sich nicht entscheiden, aber der Autor wagt es nirgends, ästhetische Gehalte zu Diskussionspunkten ausreifen zu lassen. Das Spässchen mit der Maxime einer sozialistischen Musiktheorie kommt erst am Schluss, zündet aber immerhin ordentlich: Eins, zwei, drei, wieder ’n Takt vorbei. (818) Wieso hat Tellkamp nicht nachgegriffen und die supponierte These über den Haufen geworfen, weil sie doch, indem sie insgesamt eben zwei und nicht nur einen Takt beschreibt, furchtbar falsch geraten ist? Sehr früh im Roman gibt es schon ein Zaudern, das Kopfschütteln hervorruft: Es wird Wagner mit dem Tannhäuser ins Spiel gebracht ganz ohne die Chance am Kopf zu packen, in Form von Zusätzen über seine Gesellschaftstheorie, die in bezug auf die DDR nicht uninteressant wäre, oder über die Diskussion seiner Ästhetik in diesem Land etwas zu sagen – war er doch nie wirklich Bayreuther, umgekehrt aber 150 Jahre vor dem Romangeschehen Dresdener Aufständischer, um alsbald als Flüchtiger ein halber Walliser, wenigstens ein versierter Kenner davon zu werden. Ich sage nicht, man müsse eine Beziehung zwischen den Aufständen in Dresden vor nunmehr 170 Jahren und denjenigen Ende der 1980er Jahre herstellen und Richard Wagner mitten hinein als Antrieb in diese Vorgänge setzen. Wenn aber die grosse Kunst ständig im Begriffe ist, angerufen zu werden, soll sie doch ruhig auch im Expliziten zum Zuge kommen dürfen. Denn ist es nicht letztlich falsch, davon auszugehen, dass Menschen, die die Werke schon erfahren haben, in Momenten einer Auseinandersetzung mit Gesprächspartnern oder umgekehrt in der Einsamkeit einer Gefängnis- oder sonstigen Isolation, etwa hospitalis propter, nicht ganz konkret den Werken entlang phantasieren und nur die Namen murmeln von James Joyce, Arno Schmidt u.a. wie Herbert Achternbusch? Joyce’s Werke sind Wühlkisten von Kultur- und Kunstgebilden, mit denen sie sich auseinandersetzen, und die musikalischen sind so stark durchklingend, dass John Cage es scheinbar leicht fallen musste, aus dem Finnegans Wake ein Roaratorio zu schaffen. Schmidt grämte sich ernsthaft darüber, dass die musikalische Welt mit ihm Down Town fällt, so dass er nur mit grossem Lachen Kolderupchen dessen Schallplattensammlung dem kleinen Publikum mit Suse und Nipperli vorspielen liess (Schule der Atheisten 25 und dann jeden Abend wieder) – immerhin zeigte er Mut, Schmidt, gegen die Kulturindustrie, die ihm den Musikgeschmack mit Petula Clark diktieren wollte.

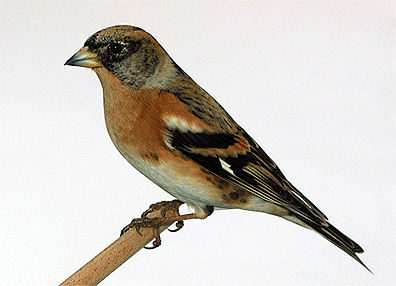


 .Das erste Zeichen bedeutet übrigens auf Englisch valley (= Tal), das zweite song (= Lied). Meine windeseiligen Chinesischkenntnisse legen nahe, das Ganze nicht voreilig als Tal der Lieder zu deuten, was einen natürlich freuen würde; denn das Chinesische unterscheidet sehr wohl zwischen Einzelwörtern, die tel quel zusammenstehen können und solchen, die in einer definierten Beziehung, etwa mittels eines Genetivs, einen speziellen Ausdruck bilden.
.Das erste Zeichen bedeutet übrigens auf Englisch valley (= Tal), das zweite song (= Lied). Meine windeseiligen Chinesischkenntnisse legen nahe, das Ganze nicht voreilig als Tal der Lieder zu deuten, was einen natürlich freuen würde; denn das Chinesische unterscheidet sehr wohl zwischen Einzelwörtern, die tel quel zusammenstehen können und solchen, die in einer definierten Beziehung, etwa mittels eines Genetivs, einen speziellen Ausdruck bilden.