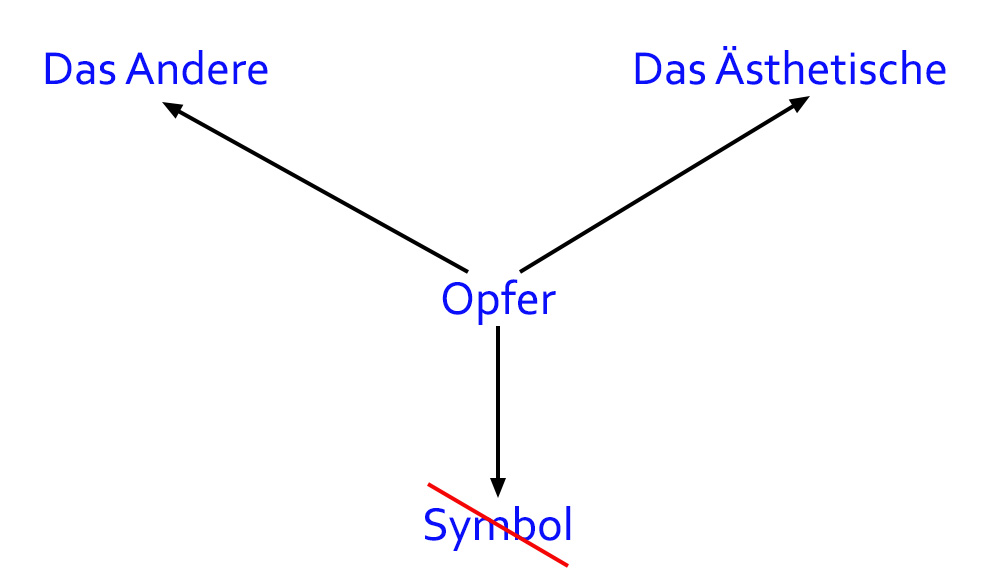Die Aktualität der Negativen Dialektik
Montag, 8. Mai 2023Adorno hat sich zeitlebens in Diskussionen und Texten darum bemüht, der materialistischen Dialektik eine verbindliche Gestalt zu geben. Erst im Spätwerk ist ihm ein grosser Wurf gelungen, unter dem abweichenden Titel Negative Dialektik. Die materialistische gehört spätestens seit da nun ganz zu Marx, wo sie, wenn denn eine ausgearbeitete materialistische Dialektik ernst genommen werden soll, als Philosophie zurückgewiesen wird.
Die Geschichte kennt viele Philosophen und Philosophinnen, und es existieren unzählige Texte von ihnen zur Philosophie im allgemeinen und zu speziellen philosophischen Fragen. Aber Philosophien, die alle ihre Fragen in einem durchgehenden Zusammenhang und im Horizont des Allgemeinen darstellen, gibt es erst sehr spät in der Geschichte, weil die Idee der Geschichte, zweifellos das Zentrum jeden Umgangs des menschlichen Bewusstseins mit der Welt, erst sehr spät als Fragestellung in Erscheinung tritt.
Kurz vor der Etablierung der Idee einer allgemeinen Geschichte wird Kants Philosophie veröffentlicht und im deutschsprachigen Raum schnell anerkannt. Wie aus einem Guss steht das Riesenwerk da, eine allgemeine Erkenntnistheorie, die klar die Grenzen beschreibt, bis wohin das Zusammenspiel von Verstand und Vernunft eines Jedesmenschen Erkenntnisse produzieren kann (die Grenzen erscheinen für unsere heutige Erfahrungswelt als sehr eng gezogen), was im allgemeinen für den Menschen gut zu tun ist und was nicht (viel Freiheit ist für die konkreten Einzelnen der politischen Gesellschaft nicht vorgesehen) und welche Fähigkeiten vorausgesetzt werden, wenn das Zusammenspiel zwischen den Erkenntnisprozessen und ihrer Realisierung im Gesellschaftsleben gelingen soll. Der Anerkennungsprozess schafft sehr schnell, gerade weil der Begriff der Geschichte in dieser Philosophie noch erst eine Randerscheinung ist, ihre inneren Unstimmigkeiten zutage. Sie ist ein imponierendes System, aber alles in ihr ist so sehr formalistisches System und also ignorant gegenüber der Flexibilität der substantiellen gesellschaftlichen Sprache, dass im Zuge dieser Kritik eine Philosophie herauswachsen muss, die sich ihr als Ganzes entgegenstemmt.
In Hegels Philosophie, der zweiten totalen erst in der gesamten Geschichte der Philosophie, sind alle Kategorien und formalen Bestimmungen Kants durch einen einzigen Begriff ersetzt: durch den Begriff selbst oder den reinen Begriff. Was erkannt wird, ist immer Begriff und das komplexe Erkannte begrifflich. So rein der Begriff in der Philosophie dasteht, ist er immer auch noch in einen Zusammenhang eingebunden. Dieser Zusammenhang, in dem der Begriff in Hegels Denken verankert ist, hat die Besonderheit, dass man mehr versteht von dieser Philosophie, wenn man sie weniger wie bei Kant als Erkenntnistheorie denn, erweitert, als Wissenschaftstheorie betrachtet. Die Philosophie breitet nichts weniger aus als eine Theorie, die beschreibt und begründet, wie das wissenschaftliche Wissen in der Geschichte der Menschheit entstehen, sich entwickeln und in materiellen oder immateriellen Technologien und Techniken gesellschaftlich realisieren konnte.
Erkenntnis geschieht nur durch das vernünftige Subjekt. Der Akt der Erkenntnis ist die Identifikation. Was erkannt wird, ist die Identität eines Objekts oder ein identisches Objekt in einem Zusammenhang, der aus unendlichen Massen von Nichtidentitäten besteht. Der Zusammenhang ist äusserst zentral, auch wenn er zunächst immer abstrakt und unzugänglich erscheint: als reiner Gegensatz zum Erkannten. Ist die Erkenntnis vollzogen und gelungen, hat man es mit einer dialektischen Identität zu tun: mit einer Identität der Identität und Nichtidentität (die hier eben der Zusammenhang selbst ist). Ein solches Objekt steht immer schon in der Geschichte und ist nicht wirklich stabil, sondern Moment einer vorerst abstrakten Dynamik. Als nicht mit absoluter Gewissheit Gewusstes hat es den Drang, über sich hinauszuweisen. An dieser Stelle ist Hegels spekulative Dialektik besessen und kennt nur eine Lösung: das, was weiter treibt und zur Korrektur der mengelbehafteten „Erkenntnis“ führt, ist immer nur wieder der identifizierende Akt des vernünftigen Subjekts.
Wie aber, wenn das mangelhaft Erkannte und nur schlecht Begriffene, das zu einem wirklichen Moment in der wirklichen Gesellschaft geworden ist, sich zwar weiter entwickelt, in dieser Entwicklung aber entschiedener Massen, also zweifelsfrei, zu einem solcherart neuen Objekt wird, das noch schlechter als das vorangegangene beurteilt werden muss? Woher kommt das Schlechte auch in denjenigen Objekten, die doch in einem wissenschaftlichen Umfeld geschaffen wurden?
Hegel war in seinen Ansprüchen gefangen. Wenn der Geist in den Formen des Wissens zu sich selbst kommen soll, muss der Philosoph, der ihn beschreiben will, diesem eigentümlichen Logizismus nachgeben und die Wirkungsweise des Nichtidentischen in der Geschichte der Welt, das Nichterkannte, Diffuse, Irrationale, letztlich überhaupt den beschreibbaren Zusammenhang, in dem ein Objekt steht, verleugnen. Eine dialektische Philosophie ohne Totalität, in der das Ganze als das Wahre erscheinen kann, ist für Hegel nicht denkbar. Die Philosophie zeigt ungehemmt den Werdegang zum Ganzen oder zum absoluten Wissen auf, auch wenn es im System nichts Weiteres ist als eine Annahme.
Diese Idee, dass Dialektik einen Begriff der geschichtlichen Totalität immer schon mit sich bringt, sieht Adorno auch bei Marx. Er weist die Marxsche Lösung deswegen von sich, weil seine Analysen ohne Programm der Planwirtschaft unstimmig würden. Aber die Planwirtschaft hinter dem Eisernen Vorhang nach der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts sieht klarerweise nicht so aus, als könne man sie als Alternative zur kapitalistischen Produktionsweise ins Auge fassen. (Steht die Frage nach der Möglichkeit einer eigentlichen Philosophie heute nicht im Zentrum, ist die Kritik an Marx auch weniger rigide. – Sartres Dialektikverständnis ist auch in seiner ausufernden Darstellung zu sehr auf Gruppenprozesse fixiert und ohne gesamtgesellschaftliche Grundierung, als dass man seine Kritik der dialektischen Vernunft anders als einen unter den vielen anderen Texten in der Philosophie begreifen könnte.)
Wenn einer ein Leben lang ausgefeilte Texte zu philosophischen sowie gesellschafts- wie musikphilosophischen Fragen publiziert hat und sich dann fragt, ob eine Philosophie heute noch möglich sei, ist das Werk, das er als Antwort darauf verfasst, eine Besonderheit. Man darf mit Fug also die Negative Dialektik als Philosophie ablösen von der Art und Weise, wie Adorno seine intensiven, nur schwer zu referierenden Texte verfasst hat. Auf diese Weise fällt einem das Leichte und Schlagende zu, also das, was in ihr als Philosophie mit der heutigen Wirklichkeit in Korrespondenz steht. Man darf vielleicht staunen, wie sehr die erlebte Wirklichkeit Gehalte der Philosophie eines der sperrigsten Philosophen widerspiegelt, die in ihr noch quasi als anmassende, chancenlose Forderungen angelegt wurden.
Adorno stellt Hegels Dialektik nicht vom Kopf auf die Füsse, sondern sprengt den Mechanismus, der ihre Entwicklung zu garantieren scheint. Hegels Behauptung ist leer, es wäre objektiv in der Geschichte immer das Subjekt, das die Entwicklung vorantreibt. Dieser Vorrang des Subjekts, der in der kantischen Philosophie so immens progressiv war und aus dem blinden Rationalismus hinausführte, ist erschütterbar, sobald die Geschichte (aber natürlich immer auch schon: die Gesellschaft) in den Blick genommen wird. Es erfolgt eine subtile, aber äusserst folgenreiche Drehung im Verhältnis von Identität und Nichtidentität.
Erkenntnistheoretische und ontologische Philosophien lassen sich nicht miteinander vergleichen. Trotzdem darf man an dieser Stelle die Fundamentalontologie Heideggers zur Seite nehmen. Adornos Akt der leichten Drehung in der Dialektik heisst bei ihm Kehre, und sie ist nichts anderes als die Forderung, die Beschreibung des Seins aus der Anspruchssphäre des Subjekts zu lösen und das Sein ohne die Übergriffigkeiten des Subjekts aufscheinen zu lassen, letztlich das im Denken Sprache oder Wirklichkeit werden zu lassen, was nicht Sprache sein kann. Aber man ist da in einem Bereich des Ungefähren, der der negativen Dialektik mitnichten eigentümlich sein soll.
Das Nichtidentische ist alles, was noch nicht identifiziert ist, zu dem auch das gehört, was möglicherweise gar nicht identifizierbar ist. In einer reinen Erkenntnistheorie kann es einem unwohl werden mit so viel Irrationalem, Unbekanntem, Unendlichem. Situiert man den Erkenntnisprozess aber in der Gesellschaft mit ihren pädagogischen Institutionen und den Systemen der Transformation und Verwertung von Erkenntnissen, wird das Nichtidentische griffig. Wissenschaftstheoretisch bildet der Begriff des Nichtidentischen nichts anderes als den ganzen Komplex der Randbedingungen ab, die einer Theorie und allen Technologien zugeordnet werden können. Aus dem progressiven Vorrang des Subjekts in Kants kritischem Rationalismus wird die Ideologie des Logizismus bei Hegel und als Antwort darauf endlich der Vorrang des Objekts in der Negativen Dialektik, die in ihrer Besonderheit nichts anderes tut als hinter jeder Theorie herzurufen: Vorsicht in der Anwendung!
Wikipedia zeigt unter „Deepwater Horizon“ die Katastrophe im Golf von Mexico mit Start am 20. April 2010. Die Besitzerin der Plattform, die in Zug domizilierte Transocean, (sie vermietet bis 2013 die Bohrinsel für eine halbe Million Dollar pro Tag an BP), schreibt dazu nur kurz auf ihrer Website (3. 5. 2023): „A reminder of the over-arching importance of safety: the Macondo tragedy brought the loss of 11 crewmembers on the Deepwater Horizon on April 20 in the U.S. Gulf of Mexico. We will never forget our lost colleagues.“ Dank dieser Schweiz-Verbundenheit kam es zu einem aufschlussreichen Interview in der Wochensendung Samstagsrundschau des Schweizer Radios. Gesprochen wurde mit einem Professor der Eidgenössischen Technischen Hochschule von Zürich (ETH).
Das Statement des ETH-Vertreters kam wie aus dem Zentrum der spekulativen Dialektik geschossen: Alle Anlageteile des Bohrlochs und der Ventile würden dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und gelten als State of the Art; keiner Bau- oder Konstruktionsfirma wäre etwas vorzuwerfen. Die materiellen Stücke am Bohrloch, im Loch selbst, auch die des Bohrers und natürlich der Plattform wären zu keiner Zeit in Frage zu stellen gewesen. Das ist es, was einem negativen Dialektiker den Magen umdreht und ihn an der Vernünftigkeit der Welt zweifeln lässt. Die ETH funktionierte im Jahre 2010 wie ein Verein selbstgenügsamer Hegelianer: Wir vermitteln die Theorien der Grundlagen der Wissenschaften, die Einzeldisziplinen selbst, die Verfahren ihrer Umsetzung in Techniken und Technologie, dazu auch ganze Lehrgänge für die Tricks der Kontrolle. Wenn dann noch etwas schief geht, hat man es mit höherer Gewalt oder schlechtem Willen zu tun. Aber das Wissen, das vermittelt wird, ist institutionell garantiert und könnte nur in Akten der Irrationalität infrage gestellt werden.
Die Frage ist, ob das skandalöse Statement des Professors auch tatsächlich der Wirklichkeit entspricht. Ist es wirklich so, dass die Umwandlungsprozesse des Wissens in isolierten Abteilungen geschehen, und ist es wirklich so, dass die Kontrolle erst am Schluss der ganzen Kette in Eigenregie organisiert wird? Mathematisch-metrische Grundlagen, Physik, Chemie, Biologie, Erdwissenschaften, Computerwissenschaften, technische Wissenschaften, Ökonomie und Politik: Werden die Kontrollprozesse erst auf den Feldern der Ökonomie und der Politik organisiert? Oder haben die Technischen Hochschulen wie die ETH nicht längst schon eingesehen und sich dahingehend organisiert, dass die Notwendigkeit von Kontrollwissen schon auf den ersten, abstrakten Ebenen des Wissens gegeben ist?
Mitte der 1960er Jahre erschienen die normativen Implikationen der Negativen Dialektik neu und dunkel, vielleicht sogar wissenschaftsfeindlich. Aber sie korrespondierten mit gesellschaftlichen Impulsen, die langsam, aber stetig von einer grösseren Allgemeinheit wahrgenommen wurden: Warnungen vor dem autoritären Staat, vor der ökologischen Katastrophe (oder, besser: vor den verschiedenen ökologischen Katastrophen) und vor dem militärischen Aufrüstungswahn wurden allenthalben in verschiedenen Gruppen immer lauter. Nun explodiert das in allen Winkeln der Weltgesellschaft, und man erkennt die Negative Dialektik als nichts anderes denn die Philosophie, die ihre Zeit in Gedanken fasst; ihre Aussergewöhnlichkeit besteht einzig darin, dass sie ungleich der Eule der Minerva so früh erschienen war.

 Eisten-Stellinu (Saastal)
Eisten-Stellinu (Saastal)