Endlich ernsthaft Frühling!
Mittwoch, 21. März 2007
|
|
|
|

Immer wieder von neuem gruusig und schmierig zu sehen, wie Material der eigenen Website, an dem in jedem Einzelfall lange gearbeitet worden war, von Leuten geklaut und auf idiotische Weise als Eigentum für ihre Zwecke weiter verwendet wird. Diesen Text, der als kommerzielle Werbung dasteht, habe ich keineswegs jemals so geschrieben oder zur Weiterverwendung freigegeben. Was ich einst verfasste, stünde auf dieser Seite: www.ueliraz.ch/rezensionen/chaurasia.htm
Der dumme Dieb im Team des Shaktishops hat den Text nicht verstanden, meint deshalb um so dreister, einige isolierte Sätze daraus wären doch gute Werbesprüche für die CD, die ganz andere Menschen einstens gemacht hatten, in der Tat grosse Künstler, und die sie vom Shop primitiv wie Panzerdealer verkaufen, weil sie glauben, zum Gebrauchs- oder Kunstwert ihrer Waren keine Beziehung haben zu müssen. So genial und wundersam die Erfindung des Internets einem erscheint, manchmal ekelt es nur noch, weil insbesondere die regressiven Verhaltensweisen, wie zuvorderst eben der ganze Werbepiss, einem als sein eigentlicher Inhalt entgegenschwappen.
Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit im Partygeplapper, und man sieht sich einem Werk als Geschenk gegenüber, weil man es wie in jenem eben eingestanden noch nicht gelesen habe, „Das Dorf in den Bergen“ (1908) von C.F. Ramuz (1878-1947). Da der topologische Fehler auf Seite 13 (Ausgabe 1984) stutzig machte, in dem ein rechtsabzweigender Weg auf einer Strasse, die einen Hang durchquert mit dessen Tiefe rechts (die Pontisschlucht), hinaufführt (ich kenne die Stelle gut, mit paarenden Vipern nicht weit darüber), führte eine Googleanfrage nach Einschätzungen von Ramuz durch andere nur zu schnell auf die eigene Site, wo eben seine Gleichgültigkeit gegenüber topographischen Fälschungen schon vor zehn Jahren ihm zum Vorwurf erhoben wurde. Wie wären dieser und ein paar zusätzlich ausgeliehene Texte heute zu lesen, ausserhalb des eng gesetzten Rahmens einer Lektüre mit Gehalten ausgerichtet nur aufs Wallis? – Ramuz war aufgewachsen in Lausanne und hat auch später wieder, nach Jahren in Paris, immer in dessen Nähe gelebt, an Orten mit Namen fast wie in der Französischstunde unter der Spitzmundmaîtresse: 1914-1916 in Cully, bis 1928 in Ouchy, schliesslich in Pully près Lutry. Das Wallis hat er 1907 kurz in Chandolin beim Maler Edmond Bille kennengelernt (dessen Sohn den Walliser Dichter der nächsten Generation, Maurice Chappaz, daselbst begrüsste) und ab 1906 viele Male in Lens, öfters beim Maler Albert Muret).
„Das Dorf in den Bergen“ war aus einem Verlagsprojekt entstanden, das die Zusammenarbeit des Dichters mit dem Maler und Zeichner vorsah, um eine Landschaft in Poesie mit einem Fundament im realistischen Bild zu gestalten (nicht ein einziges Exemplar der Originalausgabe mit den Bildern Billes ist in der Landeshauptstadt ausleihbar, und die Illustrationen in späteren Ausgaben sind ohne Frage grauenhaft). Da keine Ortsnamen gegeben werden, ist es eine wesentliche Herausforderung, die Landschafts- und Wegbeschreibung selbst nachzuzeichnen. Das funktioniert auch meistens, von Muraz über Sierre, Chippis und Chandolin bis zum Illhorn nördlich und dem Schwarzsee südöstlich. Stimmen die Zeitangaben aber nicht (vom See zum Dorf ist es die Hälfte der Ramuzschen Zeit), schwimmt die ganze Landschaft im Trüben herum, zumal man nicht versteht, wieso die anderen Dörfer des Val d’Anniviers, die doch immer fürs Leben im einzelnen Ort auch massgebend waren, nirgends ins Spiel gebracht werden, das träg auf den wenigen Seiten einer Kurzgeschichte den Ablauf in den vier Jahreszeiten zum Thema hat.
„Die Herrschaft des Bösen“ (1914/1917) enthält keine Handlungen, die eine Referenz in der Landschaft erforderten. Ein Dorf irgendwo, ein Tal irgendwo, und nichts verführte einen dazu, sich eines aus dem Wallis oder aus der Waadt vorzustellen. Knapp vor der Bekanntschaft mit Strawinsky geschrieben und fertiggestellt während der gewachsenen Freundschaft, enthält die Geschichte, die weder als Allegorie noch als Moralkritik ernsthaft zu bezeichnen wäre, Bezüge zu dem russischen Märchen, das zum Anlass auf der Seite Strawinskys für die Histoire du Soldat geworden war, die sowohl im Text von Ramuz wie in der Komposition 1918 fertig wurde.
Wieder ist es indes die Landschaftsbeschreibung, die einem die Lektüre des Buches „Die grosse Angst in den Bergen“ (1926) schwer macht. Nur ein einziger Geländename kommt zum Zuge, Sasseneire, und zwar als Alp, nicht als Berg, wie er im Wallis, eher ungewöhnlich, allein mit seinem Eigennamen dasteht. Keine Vorstellung, und sei sie noch so abgedreht oder gegengewendet, kann dem Dichter folgen; weder irgendein Platz im Val d’Hérens, von dem aus man den Sasseneire sehen würde noch im Val d’Anniviers oder Moiry hält dem Gemurkse mehr als ein paar Seiten der Geschichte stand. Je ernsthafter man dem Dichter folgt, desto übler dreht sich die Welt im Magen.
Im „Farinet oder das falsche Geld“ (1932) scheint Ramuz die Sicherung durchgebrannt, als ob er die Form der Darstellung tel quel aus dem Wesen dessen, den sie doch nur beschreiben soll, übernehmen zu müssen meinte, Falschgeld und Finte den herrschenden Zwängen. Farinet war Italiener, nicht Schweizer, produzierte sein Falschgeld im hintersten Winkel von Martigny-Bourg, wo man heute den uralten Dächern entlangfährt wie eine Katze auf ihnen umherstreift, nicht in Saillon, und dies in 20 Rappen Stücklein, nicht in massiven goldhaltigen 20 Frankenstücken. Ramuz‘ Farinet ist kein Werk ernsthafter Dichtung, sondern durch ungehemmtes Lügen blöder Kitsch. Was fehlt, ist die innere Notwendigkeit der Poesie unabhängig der empirischen Einzelheiten, auf welche gehetzte Weise der arme und armselige Mensch Farinet in welchen brutalen ökonomischen Nöten handelte und in welchen grobschlächtigen Walliser Verhältnissen er scheiterte – den Menschen ein Held nur aus ihrer eigenen Solidarität, nicht wie Ramuz daherschreibt aus einer vermeintlich romantischen Grösse. (Willi Wottreng beschreibt das alles ausführlich 1995.)
„Derborence“ (1934) respektiert die Namen im Gelände mit Ausnahme der zwei Ortschaften, in denen die Protagonisten gewöhnlicherweise leben: Aven und Erde/Premploz am Eingang zur Schlucht nach der Alp Derborence, wo ein Bergsturz Mitte September 1714 und einer noch einmal Ende Juni 1749 von den Diablerets herunter tatsächlich passierten, werden durch Aïre (in Wahrheit eine Alp darüber gelegen) und Premier (Phantasiename) ersetzt. Ramuz hält sich an das, was man von der Naturkatastrophe weiss, und seinem phantasierten Geschehnis folgt man nicht ohne Unwillen, zumal die ganze Schreibweise in den kleinen Formen gewiefter erscheint als in den früheren Werken. (Die Zeitangabe von Tsamperon nach Derborence ist an des Teufels Haaren herbeigerissen, lässt sich aber überlesen.) Weil man es wie beim Farinet gewagt hat, diese Geschichte zu verfilmen, kann man sich ein Bild von der vielgerühmten, mit der Moderne ineins gesetzten Ramuzschen Romanform machen, die ganz der Schnitttechnik mit vereinzelten Momentaufnahmen nebeneinander montiert vertraut, zusammengehalten in beliebigen Vor- und Rückblenden. Die Erinnerung kennt den Film nur noch als einzige Lächerlichkeit, weil eben nur die Bilder übrigbleiben und nichts von einem inneren Zusammenhang, der den Anfang im Schluss zu rechtfertigen vermöchte. Weder im Buch noch im Film wird einem etwas auf den Weg mitgegeben, das darüber nachdenken liesse, warum dieses Gebilde geschaffen wurde. Ist das der kritisch-vernünftige Grund, weshalb Gymnasiastinnen vom Waadtland über den Pas de Cheville durch die Gegend ins Wallis latschen und ihr Leben lang behaupten werden, nie etwas von dem waadtländisch-walliserischen Dichter gehört zu haben, der diese Einöde, so wie sie den schlappen Kindern erscheinen mag, zu neuem Leben erweckte?
Ramuz hat deutlich gemacht, dass ihm von seinen eigenen Werken der „Besuch des Dichters“ (1923) am besten gelungen schien. In der Tat funkte es unverhofft, als ich ahnungslos durch Epesses wanderte, zum ersten Mal. Die Erfahrung der Landschaft ruft den ganzen Text im Gedächtnis ab, das ihn nichtsdestotrotz als bieder und langweilig abgespeichert hatte. Ramuz war wohl deswegen glücklich über ihn, weil er für ein schlechtes Gewissen keinen Anlass bot – die Örtlichkeiten, etwas gar fad so ganz ohne Bäume und das Ganze doch tief in der Senke, sind nicht erschwindelt; die fünf oder sechs Schattenspender des Korbmachers dicht am Eingang des Dorfes genügen, einen weiten Text lang die künstlerische Wahrheit am Leben zu halten. Für uns geht sie aber entschieden zu wenig weit.
Es ist immer dasselbe mit der kleinen Kunst: Nonchalance gegenüber der Aufklärung oder dem Politischen, gegenüber dem Material (Ramuz ignorierte Joyce), gegenüber den gesellschaftlichen Momenten. Man fühlt sich gegenüber der Tatsache unwohl, dass auch ein autoritär Konservativer die Gehalte dieser Kunst vertreten könnte und sie in denselben Formen wiedergeben würde, weil sie sich gegenüber den entscheidenden Fragen indifferent verhalten. Man muss es sagen, dass die spontansoziologischen Hypothesen in den drei Essays „Menschenmass“ (1933), „Fragen“ (1935) und „Bedürfnis nach Grösse“ (1937) ein Zeugnis äusserster Hilflosigkeit abgeben. Eine Affinität zum Faschismus wie zeitweilig bei Strawinsky vis-à-vis der italienischen Variante scheint zwar an keiner Stelle auf, aber der stierköpfige Verzicht irgendeiner Bezugnahme auf objektive theoretische Gehalte in engstirnigem Drauflosdenken verwischt alle Notwendigkeit, wenigstens diesem gesellschaftlichen Gebilde gegenüber eindeutig die Haltung des Widerstandes einzunehmen. Weder in den literarischen noch in den genannten pseudo-diskursiven Texten entstehen Zusammenhänge, in denen einzelne Momente so etwas wie Erkenntnis zutagefördern könnten. Es ist schon recht, wenn der sterbende Mensch sagt, es ist alles gut; dem Lebenden indes wird der Satz schnell zum Ferment hässlicher Bigotterie.
Ich will nicht so weit gehen und behaupten, es gäbe einen Text von Ramuz, den man mit Fug zur Lektüre empfehlen könnte. So unsensibel der Titel erscheint, ist trotz allem Negativen „Die Trennung der Rassen“ (1922) diejenige Geschichte, die ich am ehesten goutierte. In Lens ausgeheckt und geschrieben, respektiert sie die topographischen Gegebenheiten auf beiden Seiten des Rawil, mit Ausnahme des Dorfes selbst, von dem sich nicht sagen lässt, ob es sich um ein Quartier in Ayent (Arbaz, St-Romain etc.) handelt oder um Icogne oder eben, naheliegender, Lens. Die Geschichte über den Raub eines heiratslustigen Mädchens aus der Lenk (nach Lens… – aber Ramuz spielt nicht mit solchen Gegebenheiten im Kunstmaterial) folgt solcherart einer raffinierten Spannung, dass es einem Lust macht, ihren Inhalt mit dem guten Zweck zu unterdrücken, einen Anreiz zur Lektüre nicht unnötigerweise vorzeitig abzustumpfen zu lassen. Diesen Sommer spielt der Dinotroupeau von Emosson das Prosawerk als Theaterstück in Finhaut – wie da der Gehalt, der doch so stark vom Sprach- und Konfessionswechsel abhängt, zur Geltung kommen soll, ist mir ein Rätsel; wenn es eine Mittagsvorstellung geben wird, werde ich es mir lösen lassen. (Es existiert in Finhaut eine Schmuggelgeschichte in der Gegend vom Pic de Tenneverge, die sich vielleicht ins Stück einschmelzen lässt, aber ich kenne sie nicht, weil ich dem Französisch des plappernden Postautochauffeurs einstens nicht gewachsen war.)
Einige dutzende Male während Jahren durch Lens gegangen, in blinder Ahnungslosigkeit – mit Blindheit geschlagen, weil an einem Ort, wo mit gefürchteter Regelmässigkeit danach gefragt wurde, wie ich denn die geschenkten französischen Bücher und Broschüren finden tät. Schnell nachgeschaut in einem, „Derborence“, und ein altes Dokument gefunden:

Le Manoir de Lens, hier vom Kulturingenieur besucht –
die Autoren der Histoire du Soldat
soffen in einer bescheideneren Hütte.
(P) 1974 H.H.-W.
Nicht nur hat Ramuz hier oft geschrieben, sondern auch den langen Ausflug zu Fuss mit dem Bergignoranten Strawinsky von Villeneuve durchs ganze Wallis hier oben beendet, darüber greinend, dass der Gastwirt Muret in frühester Morgenstunde am Ende des Gelages teuren Cognac auftischte statt des einheimischen echten Marcs – vielleicht keine überflüssige Illustration von des Dichters missverständlichem Drang nach Wahrhaftigkeit.

Dann also das Museum mit Materialien zu Ramuz und Strawinsky so lange verspätet besuchen gehen? „Ouverture: En période de haute saison, été et hiver les dimanches de 16h00 à 18h00“ – das gleicht eher einer Wegweisung als einer Einladung. Keine Ahnung, ob es anderes zu sehen gäbe als die bekannten Fotos von den Leuten, von den Zeichnungen, von den Bildern.

Auch wenn der Vergleich des Librettisten der Histoire du Soldat mit ihrem Komponisten vermessen scheint, gibt es eine beachtenswerte Gemeinsamkeit, die gleichzeitige Negation von Subjektivität und Wahrhaftigkeit (der antimoderne Mangel an Aufrichtigkeit allein ist kein Merkmal Strawinskys). Obwohl Ramuz in den oben erwähnten Essays versichert, Ziel der modernen Poesie sei es, dass der Schöpfer nie seine Wahrhaftigkeit verliere, kann die bloss versicherte Wahrhaftigkeit aus den künstlerischen Texten selbst nicht herausgelesen werden, weil die falsche Bescheidenheit des Autors, seine von Adorno 1923 so genannte unnaive Naivität zusammen mit den Falschangaben in der Landschaft das Ganze zwar zeitlos erscheinen lassen, aber auf eine Weise, als wäre es nie an einem Ort und aus einer historischen Zeit entsprungen; so bleibt es munter abstrakte unverbindliche Kinderphantasie, in der von einer ernsthaften und gelebten Subjektivität nicht die Rede sein kann. Die Sachlichkeit verpasst das Objektive, wenn sie die Dinge nur als einzelne benennt und sich um den Zusammenhang unnaiv und faul foutiert. Man sieht bei beiden gleich, wie es kommt, wenn die Wahrheit nicht gesellschaftlich begriffen wird: Ramuz‘ Texte wirken blöd und abstrakt, Strawinsky ist nur solange gut, wie man das Künstlerische in einem Werbespot zur Kenntnis nimmt; die Spannweite zwischen Cabaret- und Designermusik ist zu gering, als dass sich ein umfassendes Interesse breitmachen könnte. Eine längerdauernde Wirkung, die einen ins Nachdenken über die Werke verführte, stellt sich nicht ein – mit Ausnahme des Sacre und des Feuervogels, die einen das ganze Leben begleiten (und sei es auch nur als Diebesgut in den Werken von Varèse, mit Petruschka, der Nachtigall und dem Scherzo fantastique op 3). Die Ablehnung von Musiktheorie, Musikphilosophie und Theorie überhaupt ist Zeichen einer Haltung, die Musik weniger als Kunst denn als Unterhaltung versteht. Wer gar nur die späteren Werke Strawinskys studiert, landet schnell im seichten Gewässer John Adams‘, von dem jede Note ihre Abhängigkeit von der Psalmensymphonie zu feiern scheint. Im gehässigen Wort der Designermusik steckt allerdings auch etwas Geniales von Strawinsky, denn keiner macht die Klangprozesse so offen und weit, dass nirgendwo ein Mischklang trübte; alles bleibt in klaren Schichten und zerbröselt kaum einmal zu einem indifferenten Gemenge, wie beispielsweise alle Musik Prokoviefs sich dahinwälzt. Einiges am klaren Strukturgeschehen wäre auf Strawinskys neurotische Abwehr punktierter Rhythmen zurückzuführen, einiges auf die Abwehr der dialektischen Motiv- und Themenverarbeitung zugunsten repetitiver oder repetierter Blöcke; anderes ist noch heute so frisch, dass es nach wie vor zur affirmativen Auseinandersetzung Anlass bietet.
Vielleicht muss man spekulieren: Joyce hatte den „Ulysses“ und den „Finnegans Wake“ in Paris, Triest und Zürich geschrieben, nicht in Dublin, und Strawinsky den Sacre, das Frühlingsfest der russischen Bauern, wo ein auserwähltes Mädchen einen Opfertanz zur Darbietung bringt, in Clarens bei Montreux. Das Drinstecken in der Landschaft, die Ramuz zum poetischen Werk gestalten wollte, hat ihn wie zupackende Langeweile ins Stolpern gebracht. Den Missverhältnissen der Distanzen korrespondieren die Missverhältnisse in den begrifflichen Distanzierungen; es will nichts stimmig erscheinen und eine Erkenntnis will nirgendwo entspringen.
Immerhin verführte die neue Ramuz-Lektüre zur spannendsten seit langem auf allen Gebieten, zu der von Robert Craft, „Strawinsky – Chronik einer Freundschaft“, Zürich 2000. Gegenläufig zur Intention bestätigt Crafts Meisterwerk jeden Satz Adornos (der ungleich der Leerstelle im Personenverzeichnis erwähnt wird, Seite 471 durch die spöttische Brille Isaiah Berlins) – es ist aber so gut, dass man Strawinsky allen musikalischen Unsinn verzeihen (das tut man sowieso, weil auch in noch so schlechten Partien das Genialische herüberwinkt) und Adornos Finten gegen die von ihm neurotisch halluzinierten angeblich von Strawinsky (und Boulanger) beherrschten Verhältnisse auf demselben Niveau gesehen haben will; ohne weitere Düsternis bleiben sie nichtsdestotrotz wahr, weil ihr Antrieb aus der Musik selbst kommt, nicht aus der Parteinahme, deren Intensität von Anfang an und auf allen Seiten so viel Missmut erzeugte. Kann der Bergmensch Adorno einen Komponisten pausenlos ernst nehmen, der fast 10 Jahre seines Lebens in der Nähe von Bergen verbringt und schliesslich, 1952 nach einem Sturm in einer amerikanischen Berglandschaft, behütet vom Auto, sie nur beschimpft: „Ich verachte Berge; sie zeigen mir nichts.“ Nein, aber man kann den Hintergrund wenigstens berücksichtigen, die Tatsache, dass Strawinsky in die Schweiz gezogen war und nah den Bergen hat wohnen wollen wegen der Tuberkuloseerkrankung seiner Frau und der ältesten Tochter – deswegen die Aufenthalte 1913 in Leysin und 1914 in Salvan.
Weil die Kunst der Musik eindeutig und klar ist, gerät alle Kritik an ihr einfach. Die musikalischen Einzelwerke stehen immer schon in einem Zusammenhang mit allen anderen, deren geschichtliche Abfolge bekannt ist; ihre Konstruktion korrespondiert mit Standards der Technik wie die Ästhetik gesellschaftlichen Verbindlichkeiten sich nie zu entschlagen vermag, expliziere sie die eigene oder nicht. Wer im Medium der Musik nicht Kunst schaffen will, wird schnell genötigt, das offen zuzugeben; es wird immer nur sehr wenige in ihr gegeben haben. In der Poesie liegen die Verhältnisse anders. Man muss immer wieder aufs neue und auf mühevolle Weise sagen, dass ein vergangener Dichter nichts von denjenigen Elementen enthält, an denen sich Dichter und Dichterinnen von heute orientieren könnten. Ramuz lesen ja klar, weil jedes Land etwas mehr Recht in Anspruch nehmen darf als die anderen, die eigene Kunst ins rechte Licht zu rücken; vom Gesehenen wird niemand, sofern die Poesie Zukunft haben soll, für die eigene Dichtung selbst ideale Stücke weiterverfolgen wollen. Nein, auch eine extensive Lektüre des Dichters Ramuz, die den zeitweiligen Collaborateur Strawinsky kein kleines Stück weit mit berücksichtigt – und damit den erweiterten gesellschaftlichen Zusammenhang – vermag am Eindruck nichts zu ändern, der früher schon in kürzeren Lesestücken sich verfestigt hatte.
Ein prägnantes Bild von Ramuz zeichnet die Rezension der Tagebücher von Felix Philip Ingold in der NZZ: http://www.nzz.ch/2006/06/10/li/articleDJXM1.html. Dieser Text ist nicht zuletzt deswegen von Bedeutung, weil Ingolds eigenes Werk, das poetische, künstlerische, theoretische, pädagogische und das der Übersetzungen im Dienste der Moderne steht, und zwar in einem sehr grossen Licht. Man tut viel für Ramuz – er tat nur weniges für uns.
Vor aller sprachlichen ist die Handlung des Selbstopfers und des Opfers eines besonders geliebten Gegenstandes oder Wesens dem Menschen wesentlich, und sie, die auch vielen Tieren nicht fremd ist, bildet die Bedingung des Glaubens, der die blinde Naturgewalt besänftigen soll. Da in ihm die Lüge sich nicht erkennen lässt, hat er Gültigkeit nur an seinen äussersten Rändern, an dem der diskursiven Vernunft und an dem der zweckfreien Gebilde und zweckfreien Handlungen, an dem der Kunst und der Sexualität. Der späte Strawinsky war mürrisch über die Art des Erfolgs des Sacre du Printemps, weil der Spektakel des Mädchenopfers die Freude am Mädchen, das eben gar nie wirklich getötet werden sollte, überstrahlte. Dieses Mürrische ist vielleicht das einzig Wahre an ihm. Die Musik nach dem Sacre wurde so schlecht wie sein Glaube. Er hätte die Empfindungen im Opfer und angesichts des Opfers musikalisch weiter bedenken sollen, dann wäre sein falscher Ruhm nicht nötig gewesen. Denn man kann den Sacre rühmen und gerade das Spektakuläre in ihm, das wie der Name des Mädchens nicht alt wird.
Dass einer meint, ich möchte ins Werbebusiness für Zahnpaste einsteigen, ist an den Haaren meiner Zähne herbeigerissen. Dass man meint, ich möchte als Sponsor einer Zahnpastenreklame in Erscheinung treten, ist nur noch dumm & dreist.
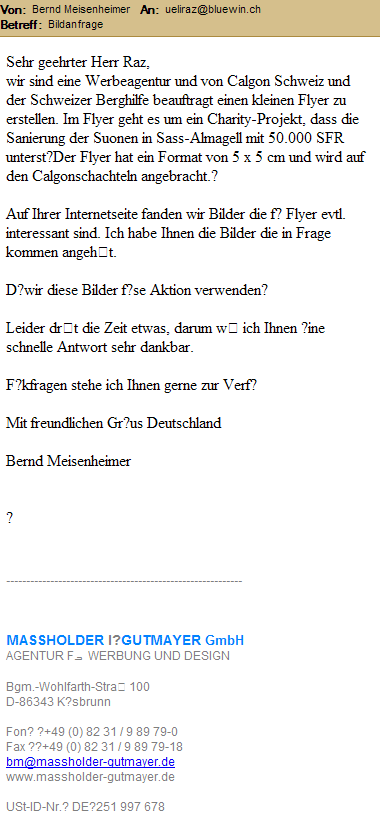
Olympus Sp-550 (neu) vs. Dimage A2 (alt)
Testbilder (1) Testbilder (2) Testbilder (3)
Die Bilder wurden wie üblich bearbeitet, also verkleinert, ausgeschnitten, in den Tonwerten angepasst und geschärft.
Strom: 4 AA Akku-Batterien, viel zu schwer für eine moderne Kamera, ein Ladegerät muss zusätzlich gekauft werden.
Speicher: nur Olympus xD-Card, sehr langsam sowohl in der Kamera wie im Cardreader, zudem störanfällig.
Sonnenblende: keine.
Tragtasche/Hülle: keine, aber die alte der Dimage ist guter Ersatz.
Gewinde für Schutzlinse: keines. Der Linsendurchmesser ist äusserst klein, über fünfmal kleiner als KB; 4.7mm bis 84.2mm decken einen KB-Brennweitenbereich von 28mm bis 500mm ab.
Farbraum: nur sRGB, kein AdobeRGB.
Die Bildqualität ist gegenüber der A2 besser, indem die Sp-550 weniger rauscht, und schlechter, weil die Linsen stärker verzeichnen. Mit autostitch werden die Weitwinkel-Panoramen ganz gut (die Panoramafunktion der Kamera selbst ist Unsinn), nur im Einzelbild, besonders mit Häuser im Vordergrund, sind die kurvig abgebildeten Senkrechten himmelschreiend.
Das grosse Zoom zeigt einen CA-Fehler, Farbsäume auf Kanten, Abdunkelungen und Unschärfen von den Ecken weit ins Bild hineinen (Vignettierung) – auch starke Abblendungen produzieren diese Fehler. Weniger stark gezoomt werden die Bilder allerdings schnell besser. Das grosse Zoom ist für Tiere in der Distanz bis 200 Meter sehr gut, für Landschaftsbilder nur, wenn leicht reduziert.

Das grosse Übel der Olympus Sp-550 ist der Fokus, in allen Belangen – bedienungsmässig, technisch und softwaremässig. Man glaubt es einfach nicht. Wegen der Kleinheit der Linsen ist die Schärfentiefe, also der Distanzbereich, innerhalb dessen scharf gestellt werden kann, vergleichsweise äusserst gering, im Makrobereich, innerhalb von 100 Metern, bei offener Blende oder stark abgeblendet (max. 8f). Bei nahen Objekten ist das eine Frage der Anpassung, die nicht weiter stört. Dass der Fokus aber ohne Ausnahme in allen Fotosituationen nur zögerlich arbeitet, nervt schon mehr – er braucht unbedingt eine Senkrechte, nach der er sich richten kann (bei waagrechten oder diagonalen Kontrastlinien muss der Apparat zur Fokussierung gedreht werden). Vollends versagt er bei Berglandschaften, wenn sie im Dunstlicht nur schwache Konturen aufweisen. Obwohl auch die Dimage A2 in solchen Fällen nicht fokussieren konnte, war das dort kein Problem, weil beim Fotografieren mit Autofokus der sogenannte direkte manuelle Fokus durch eine winzige Drehung am Schärfering sofort zeigte, wann der Apparat auf unendlich eingestellt hat. Nicht so bei der Olympus Sp-550. Die Fokusanzeige blinkt, und das Bild wird radikal unscharf – als ob es eine Unmöglichkeitkeit wäre, das Programm so zu schreiben, dass im Zweifelsfalle auf unendlich eingestellt würde. Was tun? Den manuellen Fokus benutzen – aber da schwinden einem die Sinne, und man sieht nur Hokus Pokus. Der Sucher ist so schlecht und die Lupe so klein, dass es nie einen Fall in der Landschaft gibt, wo man mittels manuellem Fokus scharf stellen könnte. Man drückt auf ein Knöpfchen (mechanische Teile zur Justierung irgendeines Wertes gibt es keine) und sieht neben dem Lupenbereich links im Sucher eine feste Skala, zuoberst das Zeichen für unendlich. Also wäre ganz oben die Schärfeneinstellung für unendlich? Nein, ein gewisser Bereich ist für einen Konverter vorgesehen (wo man den montieren könnte bleibt schleierhaft). Also etwas darunter? Ja schon, aber wieviel? Da die Schärfentiefe so winzig ist, gibt es nur eine einzige Position, auf der im grossen Telebereich in mehr als fünfhundert Meter Entfernung scharf gestellt werden kann, aber es gibt keine Marke auf der Skala und kein sonstiges digitales Zeichen, das sie auffinden liesse. Wie gesagt ist es im Feld mit dem grellen Umgebungslicht unmöglich, manuell scharf zu stellen. Lässt sich das vorher zuhause voreinstellen? Ja! Und ist diese Methode zuverlässig? Nein, und die schlechte Verlässlichkeit bezüglich dieses letzten Rettungsankers ist nun wirklich das Hinterletzte dieses Apparates. Er bietet viermal die Möglichkeit, alle Einstellungen als eine eigene besondere Voreinstellung zu speichern und dann relativ schnell mit dem Drehrad aufzurufen (nur relativ schnell, weil die vier Varianten wieder im Menue abgerufen werden müssen). Zu diesen Voreinstellungen gehört auch die manuelle Schärfe, die man mittels Stativ an einem günstigen Ort wie gewünscht erreichen kann (ich habe eine Waldgruppe ohne Äste in der Distanz von 900 Metern, wo sich das Zoom leicht scharf stellen lässt). Hat man einmal eine solche persönliche Voreinstellung gespeichert, kann man im Feld noch so viel an den Parametern verstellen, bei einem Neustart gehen alle wieder in die Position, in der man sie vorher festgelegt hat. In dieser mehrmals getesteten Annahme machte ich gestern am Genfersee die Testbilder (3), mit einer Voreinstellung für die Panoramen mit Weitwinkel und einer fürs grosse Zoom. Die manuelle Scharfstellung im Weitwinkelbereich geht problemlos, und die Panorama-Aufnahmen waren bezüglich Schärfe alle gut. Auch die Zoom-Aufnahmen waren scharf – bis fast zum Schluss. Ohne dass man auf der Skala eine Veränderung der Position feststellen könnte, muss sie sich verschoben haben. Nicht etwa durch Zurückfahren des Zooms, weil ich diese Parameterveränderung schon ganz am Anfang der Wanderung vorgenommen hatte und viele Bilder nach dieser Brennweitenveränderung trotzdem noch scharf waren. Wieso hat sich dann aber die Schärfenposition geringfügig verändern können (so gering, dass man sie im Menue nicht sieht, so massiv, dass alle Bilder danach unscharf wurden), wenn sich doch bei diesen vier persönlichen Kameravoreinstellungen nichts verändern sollte, solange die ganze Voreinstellung nicht durch einen bestimmten eingeschränkten Vorgang neu gespeichert worden ist? Keine Ahnung, aber dieser Fehler ist nun wirklich unverzeihlich und macht die Kamera zu einem Spielzeug, bei dem es immer schon Wurst ist, ob es funktioniert oder nicht.
Die Lösung wäre einfach und ausschliesslich auf der Ebene der Firmware anzupeilen: der Modus der Konverterschärfe muss ausgeschieden und stattdessen der Endwert in der Skala des manuellen Fokus auf unendlich gesetzt werden – für die grösste Brennweite, und damit für die kleineren ebenso. Wenn dann noch der automatische Fokus und das Datenspeichern, wegen dessen Langsamkeit in allen Fällen im Serienbildmodus fotografiert werden muss, etwas schneller gemacht würden, wäre an der Olympus Sp-550 nichts mehr auszusetzen.
