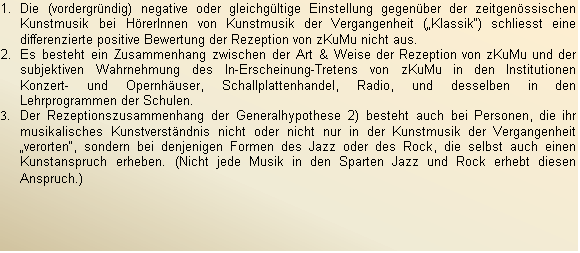
Soziologisches Institut der Universität Bern
Datenzusammenstellung eines Pretests
im Rahmen des empirischen Forschungspraktikums
1988/89
Bern, Frühling 1990
Inhalt
1. Einleitung
2. Literaturhinweise
3. Verfahren
4. Zwischenbemerkung zur Datenanalyse
5. Die Grundhypothesen
6. Die Hypothesen
7. Der Fragebogen: Randauszählung N = 445
8. Mapping Sentence Musiksoziologie
9. Structuples
10. Ausgewählte Korrelationen
1. Einleitung
Die Soziologie ist eine analytische Wissenschaft mit dem thematischen Horizont des Gesellschaftlichen. Das heißt nichts weniger, als daß die Soziologie sich dazu eingelassen hat, immer da Stellung zu nehmen, wo in einem Objekt des Wissens Gesellschaftliches angesprochen ist, und sei die Andeutung auch nur in der Form der Spur einer Ahnung; die Soziologie ist auch an solchen Orten herausgefordert, wo vom Gesellschaftlichen gar nicht in einem klaren Sinn die Rede ist. An die Soziologie wird die Forderung herangetragen, dieses auch scheinbar minime Gesellschaftliche vor dem Abgleiten in den Hang der Metaphysik zu retten. Man muß sich diesen dreifachen Zwang vergegenwärtigen, wie er auch ohne identifizierbares Subjekt herrscht: will die Soziologie Wissenschaft sein, so ist es ihr Pflicht, alles nur irgendwie Gesellschaftliche in Augenschein zu nehmen, das vordem zwanghaft von der Metaphysik in Beschlag genommen war. Und als Wissenschaft tut die Soziologie das in einer analytischen Form, in der sich nun schon die dritte Seite des Zwanges des Systematischen zeigt: diese Form kann man thematistisch nennen, und das ist – man muß es bedauern – gar nichts Schwieriges; im Gegenteil enthält das scheinbar Triviale dieser thematistischen Form offenbar nur allzuviel Verführungskraft. Charakteristisch an ihr ist, daß die begriffliche Sprechweise mit dem Bezug zur Tradition verboten ist – sie wäre philosophisch. Nur das ist mit dem Anspruch normaler Wissenschaft (Thomas S. Kuhn) analysierbar, was klar eingrenzbar ist. Die Soziologie muß alles irgendwie Gesellschaftliche zur Sprache bringen, aber sie darf es nicht eigentlich „in der Sprache zur Sprache bringen“, sondern muß jenes Gesellschaftliche als ein in seinen Grenzen klar und distinkt faßbares Thema behandeln. Das Ziehen einer Demarkationslinie gegenüber dem Metaphysischen hat zur Folge, daß das Allgemeine in der Soziologie einer permanent.en Krise ausgesetzt ist; es fällt fast unvermittelt in Identität mit dem Begriff der Praxis. Die Vermitteltheit des Allgemeinen ist nur dort noch spürbar, wo das Metaphysische der Praxis erkenntlich ist – also, gemäß der Irrationalität der herrschenden Verhältnisse: überall und nirgends. Mit dieser angedeuteten Einschränkung muß man sagen, daß es heute keine allgemeine Soziologie gibt. Es gibt nur ins wissenschaftliche Feld verstreute soziologische Arbeiten über in sich eingeschränkte Themen.
Wie nun sind die Verhältnisse in der Musiksoziologie? – Gewiß hat Adorno schon alles gesagt und sehr vieles bewirkt – solcherart, nachhaltig, daß in Paris heute mit Nachdruck und ohne falsche Scham betont werden kann, man müsse sich nun wieder vermehrt der Eigentümlichkeit der musikalischen Verfahren als Kompositionstechniken widmen; die ästhetischen Fragen seien – nicht zum Schlechten – zu einem Topos geworden, der dann zur Hinderlichkeit wird, wenn er weiter ausgezehrt wird. Das klingt gut. Es verdeckt aber, daß diese Haltung nicht in jugendlicher Unbefangenheit erwuchs, sondern dem subtilen Vermögen entspringt, Resignation in der „eigentlichen“ Domäne zu überspielen: dem Komponieren (nicht zuletzt anerkannte Meister der Musik wie Pierre Boulez sind in einem eminenten Sinn verpflichtet, sich bezüglich der Artikulation gegenüber der Reproduktion nicht auszuschweigen). Ist folglich doch nicht alles wirksam, was in den Texten Adornos steckt, oder: hat in Adornos Art des Schreibens nicht alles artikuliert werden können, weil es – oh Übermut! – eine andere Art zu analysieren nötig gemacht hätte?
Man muß diese Fragen nicht auf jeden Fall ernst nehmen, und für eine Einleitung sind sie sowieso deplaziert: sie setzen eine Übersicht voraus, wo doch nur blasse Tupfer hingesetzt werden können – dazwischen läge die konkrete Vielfalt der Bezüge. Aber sie geben vielleicht doch bereits am Anfang wieder, daß es um die Musiksoziologie nicht so leicht steht, wie ihr Objekt manchmal Formen annimmt. Im Gegenteil: es gibt so selten von ihr etwas zu hören, weil sie – als Wissenschaft – geradezu unmöglich scheint. Oder dann wirkt sie penetrant, aufdringlich und „demotivierend“, wie wir es haben zur Kenntnis nehmen können aus den Kommentaren der Befragten bei unserer Untersuchung: es wird gesagt, daß es sehr interessant sei, Einblick nehmen zu dürfen in musiksoziologische Fragen; aber wäre es denn unumgänglich, diese unbekannte und unbequeme zeitgenössische Kunstmusik derart in den Vordergrund zu stellen, daß man als Befragter wie ein Depp dazustehen habe (siehe Kapitel 7)? Das nun ist entscheidend: es wird gesagt, Musiksoziologie interessiere, aber mit der dringlichen Eingrenzung auf die Verhältnisse wie sie bestehen, wie sie gelebt respektive konsumiert werden.
Mit Bravour ist Pierre Bourdieu dieser Forderung nachgekommen, in seinem nun auch im deutschen Sprachraum zum Klassiker anvancierten Buch „Die feinen Unterschiede“. Was bei Adorno so ernsthaft die Analyse erschwert, die relative Autonomie der Kunstmusik, wird bei Bourdieu – und im Alltagsverstand – unverfroren nahezu völlig unterschlagen. Die Produkte der Musik bilden bloße Strukturelemente der modischen Repräsentation. Man hört diejenige Musik, die einem gehörig ist, die einem zusteht; daß die Einzelmenschen verschiedene Musiken auf verschiedene Arten hören, scheint in dieser Soziologie vernachlässigbar. Diese Nachlässigkeit Bourdieus darf um so mehr hervorgehoben werden, als er in der Studie über Heidegger meint herausstreichen zu müssen, Adorno hätte – der Schauplatz des Gezänks repräsentiert die Analogie – in seinem Heidegger-Essay über den „Jargon der Eigentlichkeit“ die relative Autonomie der Philosophie übersehen und die philosophischen Äusserungen unvermittelt der gesellschaftlichen Produktionssphäre zugeordnet. Übertragen auf die Musiksoziologie würde das heißen, daß zumindest Hinweise auf das relativ Eigenständige der Musik nicht ausbleiben dürften. Da Bourdieu auf derartige Hinweise gänzlich verzichtet, können die musikbezogenen Seiten der „Feinen Unterschiede“ nicht mit Befriedigung der Musiksoziologie zugezählt werden. Man muß vielleicht noch schärfer sagen, daß von Musiksoziologie, und folglich von Kunstsoziologie allgemein, bei Bourdieu nicht gesprochen werden kann. Es erstaunt denn auch nicht sonderlich, daß in den „Feinen Unterschieden“ die Texte von Adorno und Derrida als elitäre, d. h. hier falsche ja: verlogene, denunziert werden.
Eleganter und zurückhaltender bemüht sich Pierre-Michel Menger um die Frage der relativen Autonomie und der gesellschaftlichen Vermitteltheit der Musik: er legt eine deskriptive Analyse vor, und zwar eingeschränkt auf die Seite der Komponisten und derjenigen Institutionen, mit denen diese es zu tun haben – ein Bereich der Praxis, der bei Adorno entweder fehlt, oder dann gewiß auch stilisiert hat werden müssen. Mengers Buch „Le paradoxe du musicien“ gibt einen sehr tiefen Einblick in die institutionellen Verhältnisse der Kunstmusik. Dennoch: kann von hier aus eine Erklärung gemacht werden für den Umstand, daß die Situation des Komponisten derart paradox ist, daß vom institutionellen Bereich her nämlich ordentlich viel für die Kunstmusik getan wird, daß diese aber schlußendlich im wörtlichen Sinne ungehört in der Luft verpufft? Es muß darauf insistiert werden, daß das spezifisch Soziologische in der Kunst im Transfer von Werten besteht, also im Verhältnis von Produktion und Rezeption. – Hier ist somit eine Lücke offenbar, die sich wie ein schwarzes Loch zu verhalten scheint: es mag wohl am vortrefflichsten sein, sich damit nicht zu sehr auseinanderzusetzen. Trotzdem: ist die Soziologie als demokratische Institution ernst zu nehmen, wenn sie offensichtlich gesellschaftlichen Fragen ausweicht?
Das ist der thematische Kern der vorliegenden Untersuchung als Grundlagenforschung: wie kann die Kunstmusik als gesellschaftliches, aber transklassitäres, das heißt an die Reflexion gebundenes Phänomen analytisch-empirisch erfaßt werden? Wenn die Musik an die Reflexion gebunden ist, dann sind die Techniken der Marktforschung – wie Bourdieu sie einsetzt – hinfällig, weil sie auf den Bereich der manifesten Meinung eingeschränkt sind.
Die Meinungsforschung hat exakte Verfahren, Themen derart in Formen zu bringen, daß sie problemlos operationalisiert werden können, das heißt in klare und distinkte Elemente von Hypothesen zerlegt und anschließend in eindeutige Fragen geordnet werden können. Gesellschaftliche Themen, die mit dem Denken verflochten sind – wie die Kunstmusik – sind bis auf weiteres soziologisch nicht eindeutig analysierbar.
Allerdings: bekanntlich vertraut man mehr oder weniger dem Satz, daß das, was empirisch noch nicht überprüfbar ist, deswegen nicht unbedingt falsch sein muß, aber, wie man sagt, es hat eben nicht die Form der strengen Wissenschaft. Mir scheint, an diesem Satz ließe sich etwas rütteln: es gibt Phänomene, die sich empirisch fassen ließen, wenn die Methodologie als Institution von ihrer spröden Vornehmheit abließe und den Stand der Erhebungs- und Analyse-“Instrumente“ in ihre Logik miteinzubeziehen begänne (natürlich ist hierbei einmal mehr an die Kultur der leidigen Personal Computers zu denken).
Aus den Fragebogenkommentaren ist wie erwähnt deutlich geworden, daß man die Forcierung der zeitgenössischen Kunstmusik als übertrieben empfunden hat. Ähnlich anstößig steht es um das Erhebungsinstrument des standardisierten Fragebogens. Es wird gesagt, offene Interviews würden doch der „Sache“ gerechter werden: die Befragten könnten so besser differenzieren.
So leicht wie die altklugen Tips schief sind liegen die Dinge aber nicht; denn es gibt massive Hinderlichkeiten, die sich qualitativen Tiefeninterviews mit dem Thema „Musik“ entgegenstellen. Die zeitgenössische Kunstmusik ist deshalb so schwierig, weil in ihr die Momente des Rationalen in der Weise getilgt werden – und das ist ein zentrales Element ihrer Ästhetik! – daß nichts mehr sich anbietet, das „voreilig“ rationalisiert werden könnte. So etwas ist natürlich kaum im ersten Moment verstehbar, nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen.
Es gibt nur deshalb ein wie immer auch großes Einverständnis gegenüber der Klassik, weil die Gehalte ihrer Werke so leicht rationalisiert werden können, indem das Missverstehen hinter der großen Etikette des im Vordergrund begründeten Verstehens verborgen wird: die Nicht-Funktionalität der klassischen Musik und ihre souveräne Verweigerung, sich instrumentalisieren zu lassen, wird bei den gegenwärtigen HörerInnen in der Aufnahme für ihr eigenes Bewußtsein überlagert von der vordergründigen Manifestierung eines identitätsbildenden Sinnhaften, vom eingeschliffenen Metrum. Fehlt das „symmetrische Metrum“, der gleichschreitende Pulsschlag, so fehlt den Stücken der Gehalt. Das sagt das Alltagsbewusstsein.
Die Aussage ist richtig und falsch zugleich, wie bekanntlich so vieles im Leben: es ist eine Behauptung durch Rationalisierung. (Es braucht uns nicht zu kümmern, daß der Begriff der Rationalisierung selbst mehrdeutig, mithin auch nichts eindeutig Schlechtes ist.)
Wir können an dieser Stelle für die Wahrheit und die Falschheit dieser Behauptung keine vollumfängliche Begründung liefern, da sie in der Beschreibung des Wandels der Musik selbst fußt – und diese Perspektive hat fürs ganze „Empirische Forschungspraktikum“ ausgeklammert werden müssen. (Siehe statt dessen das Literaturverzeichnis.) Damit verbunden ist, daß diese sachlich befriedigende Begründung in einer Einleitungsnotiz nicht gelingen kann, weil sie eben schon auf den institutionellen Zusammenhang verweisen muß, nach dem die Musiksoziologie erst fragt: sie setzte „Vorkenntnisse“ zum Musikalischen voraus, die in den Schulprogrammen zu vermitteln wären.
Dennoch darf hier gesagt werden, daß die Behauptung des Publikums, die heutigen Stücke seien sinnlos, für unsere Untersuchung Sinn macht (wir beschränken uns ja grundlagenforschend auf die Frage, ob in solcher Weise – wie wir sie zu präsentieren versuchen – Musiksoziologie möglich ist), indem sie „untersuchungs-technisch“ fürs erste und vorläufig eine Plausibilität verschafft, wieso es schwierig ist, direkt über Musik Fragen zu stellen: befragt werden kann nur das, was bereits rationalisiert worden ist.
... Oder dann könnte befragt werden die Einstellung zu den materiellen und wahrnehmbaren Institutionen; und dies, weil auch das Bewußtsein, das in seiner Rationalisierung verfangen ist – präzis hier ist der Ort, wo der Begriff der Verdrängung systematisch vor Anker liegt – zum Ausdruck bringen kann, daß ihm etwas fehlt, um über diesen Zustand hinauszukommen. Eine der Grundannahmen ist, daß sich ein – allerdings verschämter – Wunsch nach zeitgenössischer Kunstmusik registrieren ließe. Zum Stolz unserer Resultate gehört denn auch die Tatsache, daß es den Studierenden im allgemeinen egal ist, ob mehr an zeitgenössischer Musik getan wird; deutlich wird aber angegeben, daß in der Schule mehr über sie hätte gesprochen werden sollen. (Siehe im Kapitel 5 die Fragen 35 und 36; die Einstellung zu den Institutionen ist bei Studierenden ungünstig zu befragen, weil bei ihnen der Umgang mit den kulturellen Praktiken noch nicht eingeschliffen respektive noch nicht ausgeprägt ist – das ist nicht zuletzt eine Frage des Geldes.)
Aber es läßt sich auf der anderen Seite, der theoretisch-ästhetischen Seite, wenigstens andeutungsweise zur Klärung sagen, daß das Reale des Gehaltes in der klassischen Musik, das sich noch nicht durch die Rationalisierung hat festlegen lassen, zuinnerst verkittet ist mit dem Realen des Geschichtlichen oder Politischen. Das Reale ist keinesfalls das Empirische. Aber es ist so, daß es – auch späterhin – wahrnehmbar ist eben in den „gestalteten Werken“, von denen die musikalischen selbstredend allein eine Domäne bilden (durch ihren Abhub von allem Begrifflichen allerdings eine privilegierte: Unstimmigkeiten in den Gebilden können nicht wie in der Malerei oder in der Dichtkunst metaphorisch verschleiert werden). Sind die musikalischen Gebilde also stimmig, so ließe sich an ihnen etwas vom Realen ablesen. (Natürlich ist auch bei diesen beiden Begriffen „Stimmigkeit“ und „Reales“ ihre Ambivalenz wiederum nicht zu unterdrücken.)
Sonderbarerweise scheint die zeitgenössische Wahrnehmung – nicht nur bezüglich der Musik – sich invalid zu geben (Jean-François Lyotard: Heidegger und „die Juden“, 1988, p.61f); es werden Gründe zur Beurteilung vorgeschoben, Prothesen, über die das Bewußtsein stolpert, wenn es sich zu sehr auf diese verlassen muß, durch unfreiwillige Verniedlichung der Umstände. „Wahres“ Bewußtsein würde sich an den Gebilden selbst orientieren, ohne Berufung auf den gesetzlichen Ort.
Jedoch hatten die Gebilde bereits in der Klassik der Musik ein Augenmaß verlangt, um ihrer Besonderheit gewahr zu werden, das nie allgemein werden konnte (um das zu verstehen, müßte man eine Musiksoziologie der letzten zwei Jahrhunderte zu Rate ziehen).
Heute hat das Bewußtsein nicht einmal mehr ein schlechtes Gewissen, wenn es beim Beurteilen von Musik den Begriff des musikalischen Gebildes vollends unterschlägt, um auf dem Rationalisierbaren Selbstgenügsamkeit zu üben: es sagt, das Gehaltlose der zeitgenössischen Kunstmusik zeige sich gerade darin, daß ihre Werke keine „wahrnehmbaren Gebilde“ seien...
Fehlt der gegenwärtigen Musik der Bereich des Rationalisierbaren – als unselige Gefälligkeit – so versiegt das Sprechen über sie. Qualitative Befragungen sind der wissenschaftstheoretischen Prämisse unterstellt, daß der sich äußernde Mensch einen begrifflichen Zusammenhang zum Ausdruck bringt, indem metaphorische und assoziative Erinnerungsstücke freigesetzt werden. Das Freigesetzte wird von den wissenschaftlichen InterpretInnen hinwiederum zu allgemeinen Begriffen und Kategorien in Beziehung gesetzt (wodurch erst die Aussagen der einzelnen vergleichbar werden). Das ist eine immanente Grenze der Meinungsumfrage im allgemeinen, daß die assoziative Artikulation bei solchen Themen nicht möglich ist, wo es kein Kontinuum gibt zwischen der Erfahrung und der begrifflichen Reflexion oder Artikulation.
Als vorläufiger Schluß mögen die folgenden drei Punkte illustrierend anzeigen, inwiefern es problematisch ist, sich in der Musiksoziologie allzu freizügig auf das Alltagsbewußtsein abzustützen; es handelt sich um drei Momente von konstitutiver Diskontinuität:
Ohne Berücksichtigung dieser drei Punkte werden die Aussagen des Bewußtseins über sein Verhältnis zur Musik seiner Zeit verzerrt, zumindest nicht repräsentativ, sie werden schlußendlich nichtssagend. Nimmt man diese Hindernisse in Rücksicht, so darf man das sich äußernde Bewußtsein nicht frei über Musik assoziieren lassen, man muß es in gleicherweise einschläfern wie provozieren. Diese Möglichkeit ist in der Konstruktion eines Fragebogens mehr schlecht als recht gegeben – aber sie ist es dort eher als in der bloß scheinbaren Offenheit von qualitativen Interviews.
2. Literaturhinweise
Es sind hier auch Bücher aufgenommen, die nichts zu tun haben mit der vorliegenden Untersuchung, an die man sich aber wenden kann, wenn ein Interesse über die zeitgenössische Kunstmusik spürbar werden sollte. Es sind Bücher, wie sie in den Fragen 35 und 36 als „soziologische Institution“ erscheinen.
Theodor W. Adorno: Philosophie der neuen Musik, Ffm-Berlin-Wien, 1974
Auch in:
Gesammelte Schriften Bd.12, Ffm 1975
Auch in: stw 239
ders.: Gesammelte Schriften Bde.13-19, Ffm 1971-1984
ders.: Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie, Ffm 1974
Pierre Boulez: Werkstatt-Texte, Ffm-Berlin-Wien, 1972
ders.: Anhaltspunkte, Stuttgart-Zürich, 1975
Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Ffm 1987
ders.: Die politische Ontologie Martin Heideggers, Ffm 1988
John Cage: Roaratorio. Ein irischer Circus über Finnegans Wake, Königstein/Ts 1985
ders.: A Year From Monday. New Lectures And Writings, Middletown 1979
ders.: Für die Vögel, Berlin 1984
ders.: REVUE D'ESTHETIQUE, nouvelle série nos 13-14-15, Toulouse 1987/88
David Canter (ed.): Facet Theory. Approaches to Social Research, New York-Berlin-Heidelberg-Tokyo 1985
Daniel Charles: John Cage oder die Musik ist los, Berlin 1979
Jacques Derrida: Parergon, in: La vérité en peinture, Paris 1978
Ulrich Dibelius: Moderne Musik 1945-1965, Köln 1966
ders.: Moderne Musik Bd. II 1965-1985, München 1988
DuMont Dokumente: Kommentare zur Neuen Musik, Köln 1960
Dominique Jameux: Pierre Boulez, Paris 1984
Michael Kurtz: Stockhausen. Eine Biographie, Kassel 1988
Werner Linden: Luigi Nonos Weg zum Streichquartett. Vergleichende Analysen, Kassel 1989
Jean-François Lyotard: Heidegger und „die Juden“, Wien 1988
Richard Kostelanetz: John Cage im Gespräch zu Musik, Kunst und geistigen Fragen unserer Zeit, Köln 1989
Pierre-Michel Menger: Le paradoxe du musicien. Le compositeur, le mélomane et l'état dans la société contemporaine, Paris 1983
ders.: Les laboratoires de la création musicale. Acteurs, organisations et politique de la recherche musicale, Paris 1989
Christoph Menke-Eggers: Die Souveränität der Kunst. Ästhetische Erfahrung nach Adorno und Derrida, Ffm 1988
Heinz-Klaus Metzger: Musik Wozu. Literatur zu Noten, Ffm 1980
Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn (Hrsg.): Musik-Konzepte, München. Reihe über Komponisten von Claude Debussy bis Iannis Xenakis.
Henry Miller: Mit Edgar Varèse in der Wüste Gobi, in: Musik-Konzepte 6, Edgard Varèse, Rückblick auf die Zukunft, München 1978
Hans und Rosaleen Moldenhauer: Anton von Webern. Chronik seines Lebens und Werkes, Zürich 1980
Luigi Nono: Texte. Studien zu seiner Musik, Zürich 1975
Karlheinz Stockhausen: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, Band 1, Aufsätze 1952-1962 zur Theorie des Komponierens, Köln 1963
ders.: Texte zur Musik 1977-1984, Band 5, Komposition, Köln 1989
ders.: Texte zur Musik 1977-1984, Band 6, Interpretation, Köln
Ivanka Stoianova: Geste - texte - musique, Paris 1978
H. H. Stuckenschmidt: Schöpfer der neuen Musik, Ffm 1974
Louise Varèse: Varèse, a looking-glass diary by Louise Varèse, Volume I: 1883-1928, London 1973
3. Verfahren
Wenn es stimmt, daß die Kunstgebilde mit Wesentlichem der Gesellschaft verwoben sind (wenn sie also tatsächlich Erkenntnischarakter haben, wie Adorno sagt), dann ist der Umstand, daß die Kunstmusik unserer Zeit im Abseits steht und unter dem Ladentisch gehandelt werden muß – derjenige, daß sie verdrängt wird – ein Problem für SoziologInnen: ein legitimes Forschungsthema. Die Quelle des Tatbestandes liegt in der Musik – die Erklärung der Tatsachen ist Aufgabe der Soziologie. Das Forschungsthema betrifft also die Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Kunst (etwas zu sagen zu haben…) und dem sozialen Bewußtsein (das von dieser Kunst nichts wissen will). Die Kunst läßt sich nicht vom sozialen Bewußtsein trennen, weil es keine private gibt.
Das Kernthema lautet:
Welche Vorstellungen hat das Publikum von dem, was es ablehnt oder befürwortet, – und in welcher Intensität?
Dies ist die Kleinstausgabe einer Mapping Sentence (näheres zu dieser vom Statistiker Louis Guttman praktizierten Forschungsform in Canter (ed.): Facet Theory). Wenn die Elemente dieses Satzes präzisiert würden – was äußerst lange zu dauern hat – könnten diejenigen Daten der Empirie erhoben werden, deren Zusammenhänge die Empirie erklären, nämlich den Tatbestand der Verdrängung der gegenwärtigen Kunstmusik.
Bemerkung: In diesem ersten Moment des Forschungsprozesses ist von Hypothesen noch nicht die Rede. Das Kernthema ist eine Beschreibung, keine Behauptung. Wäre es möglich, eine empirische Studie zur selben Fragestellung zu machen, in der keine Hypothesen gebildet würden?
Im weiteren Forschungsverlauf haben wir diesen Ansatz zur Seite gelegt und uns der klassischen Forschungslogik gefügt. Wir haben Hypothesen gebildet – und definiert, was immer gerade ein Mitglied der Forschungsgruppe definiert haben wollte.
Zum Beispiel Kunst:
Kunst ist ein Raum der sozialen Sinnstiftung, an der historischen und systematischen Schnittfläche von Mythos als Glauben und Philosophie als Wissen. Sind die Formen des Wissens und die Formen des Glaubens dem Zug der Geschichte ausgesetzt, so auch die Formen der Kunst.
So wenig das Wissen erbaulich ist, so wenig ist es die Kunst.
So sehr der Glaube subjektiv ist, so sehr ist es die Kunst.
Die Spannung zwischen Wissen und Glauben wird als Schönheit wahrgenommen. – Die Spannung besteht zwischen dem institutionalisierten Wissen als Wissenschaft und dem Glauben als Weltanschauung – aber auch zwischen dem institutionalisierten Bereich und dem Alltag. Die Schönheit im Alltag betrifft die Natur oder die Reize der Unterhaltung. Die Frage, wo der Bereich des Alltags
aufhört und der Bereich des Institutionalisierten anfängt kann institutionalisiert d. h. innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses betrachtet werden oder moralisch-weltanschaulich d. h. alltagspraktisch.
Die Fortsetzung ist dann wieder ernster zu nehmen: die Fassung des Themas in Grundhypothesen, die Bildung von strengen Arbeitshypothesen und die nachträgliche Konstruktion der Mapping Sentence aufgrund derselben (siehe die diesbezüglichen Abschnitte).
Nach dem strengen Teil der Hypothesenbereinigung kommt die lockere Phase der Konstruktion des Fragebogens. Das wäre eine angenehme und schöpferische Arbeit – wenn sie nicht dem Diktat zu gehorchen hätte, wonach keine Frage formuliert werden darf, die sich nicht als Teil einer Hypothese ausweisen kann. Das ist die eine Schwierigkeit, der man sich nach kurzer Zeit zu fügen lernt. Die andere Schwierigkeit ist grundsätzlicherer Natur und, wie in der Einleitung angetönt, bei unserem Thema in nächster Zeit wohl auch kaum zu bewältigen: alle Fragen müssen valide und reliable sein.
Die Validität (Gültigkeit) provoziert zwar ein großes, letztlich aber kein unüberwindbares Problem. Die Bedeutung einer Frage muß die Bedeutung eines Teiles einer Hypothese repräsentieren. Im schlimmsten Falle wäre das eine Frage des Definierens.
Arger steht es um die Reliabilität, d. h. die Verläßlichkeit einer Frage, ihre Einheitlichkeit. Denn was als objektive Bedeutung intendiert wird, muß auch als ein solches rezipiert werden – und zwar exakt.
Das Instrument zur Prüfung der Fragen auf ihre Reliabilität ist der Pretest. Man kann unsere ganze Studie einen Pretest nennen: es wird geprüft, ob das gestellte Thema sich empirisch umsetzen läßt, wissenschaftlich analysieren läßt. Trotzdem gibt es in diesem Pretest bereits einen Pretest. Hier wird im groben geprüft, ob Fragen vorkommen, die offensichtlich nicht verstanden werden. Das Verfahren ist so, daß man den Fragebogen von einigen wenigen Personen ausfüllen und kommentieren läßt. Bei uns haben alle am Forschungspraktikum Teilnehmenden je zwei Studierende den Test durchführen lassen. Aufgrund dieses Testlaufes sind einige wenige Korrekturen vorgenommen worden – zu sehr konnten wir uns auf die Kritiken nicht einlassen, die Studie wäre nicht zustande gekommen. Es sind aber doch zwei Fragen zu erwähnen, die diese Prüfung grundsätzlich nicht bestanden haben:
a) Paul Sacher gilt als einer der reichsten Schweizer. Als Mäzen hat er die Kunstmusik im 20. Jahrhundert entscheidend gefördert – ohne ihn hätte vieles in ihr gar nicht entstehen können. Glaubst Du, daß diese tatsächliche Beziehung der „Finanzaristokratie“ mit der Neuen Musik in dieser selbst auch spürbar ist, in der vornehmen Art der Musik oder in der vornehmen Art ihrer Aufführungsweise?
b) Klaus Theweleit macht in seinem neuen „Buch der Könige“ die Beobachtung, daß einer Single im Radio heute eine Empfindung entspricht wie früher den einzelnen Gedichten. – Daß das eine richtige Beobachtung ist, ist klar. Findest Du aber, daß für jede Musik gelten solle, daß ihr etwas Sinnvolles entspräche?
Schließlich wird der Fragebogen verschickt. Das Zufallssample besteht aus 450 Studierenden in Bern und 450 in Basel. Nach einem Monat haben wir, ohne zu mahnen (wir wollten die Adressen nicht im Doppel haben), aus Basel 223 Fragebogen zurückerhalten, von den BernerInnen 218. Zusammen mit den vier Exemplaren ohne diesbezüglichen Angaben sind das 445 auswertbare Fragebogen. Das ist eine (ansprechende) Rücklaufquote von knapp 50%. Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern entspricht demjenigen an den Universitäten (siehe Randauszählung Frage 47). Es scheint dies alles in allem ein bestätigendes Licht auf die Idee von repräsentativen Zufallsstichproben zu werfen.
4. Zwischenbemerkung zur Datenanalyse
1. Die „eigentliche“ Datenanalyse wird Primäranalyse genannt. Sie führt zu einem Resultat, das darüber Auskunft gibt, ob die Aussagen, die ein Thema formieren, haltbar sind oder nicht. Unsere einjährige Forschungsarbeit ist keine ausgereifte thematistische Studie; als Grundlagenforschung fragt sie bescheidener, ob das supponierte Thema „Die gesellschaftliche Verdrängung der zeitgenössischen Kunstmusik“ als Thema klar und distinkt eingrenzbar, d. h. vor metaphysischen Ausrutschern zu schützen ist und dadurch wissenschaftlich analysierbar wäre. Wie in der Einleitung und im obigen Absatz zum Pretest bereits ausgesprochen, müssen wir sagen, daß es uns nicht gelungen ist, eindeutige Fragen zu stellen. Das „Thema“ konnte noch nicht in eine befriedigend faßliche Form gebracht werden. Zum Trotz dieser Umständlichkeit behandelt die Datenanalyse das Material, als handele es sich um „Daten“ einer abgeschlossenen Studie.
2. Der Komplementärausdruck zur Primäranalyse ist die Sekundäranalyse. Im strengen Sinne wäre dies eine Datenanalyse bereits vorliegender Daten – die im Zusammenhang also einer anderen Untersuchung erhoben wurden – unter neuen „Daten-uneigentlichen“ Forschungsfragen, d. s. Forschungshypothesen. In einem etwas largeren Sinn fallen unter die Sekundäranalyse alle Aussagen über die Untersuchungspopulation, die nicht bereits in Hypothesen enthalten sind. Hierzu können wir sagen – wie ebenfalls schon in der Einleitung erwähnt – daß wir keine Diskriminierung bezüglich musikalischer Vorstellungen haben vornehmen können zwischen den Orten Bern und Basel, zwischen den Geschlechtern, der religiösen Haltung, der Studienrichtung, der Politik… Abschnitt 10 ist teilweise eine Primäranalyse, in der Hypothesen überprüft werden, zur Hauptsache aber eine sekundäre, weil die entscheidende Variable zur Hypothesenüberprüfung – das Interesse an zeitgenössischer Kunstmusik – aus den Daten gar nicht hat herausgelesen werden können.
3. Zusatz 1998, zum Überflüssigen in den empirischen Datenerhebungen.
Nicht jede empirische Untersuchung steht als Marktanalyse im Dienst der Verwertungslogik des Kapitals oder der Verwaltungsplanung, die jener, als Zeichen lesbar ihrer Irrationalität, gehörig ist, und aufklärende Soziologie zeichnet sich dadurch aus, daß sie sich von denselben bewußt distanziert. Gerade im musiksoziologischen Forschungsfeld wirkt es absurd, die Erkenntnisse so zu begreifen, als ob mit ihnen über soziale Zusammenhänge besser verfügt werden solle. Die Forschung hat der Bewußtmachung zu dienen – wo unbedarft auf ein Mehreres abgezielt wird, droht der Zerstörungssog der Dialektik der Aufklärung.
Die effektiven Daten verstärken bloß die Konturen der Skizzen, die vielleicht noch etwas diffus gewesen sein mögen, als man sie im Verlauf der Forschungsplanung anfertigte – aber in ihnen sind doch alle möglichen Erkenntnisse bereits streng vorgezeichnet. Man hat sich in jedem Moment zu fragen, was es hilft zu wissen, daß nur 44% und nicht 53% eines gewissen Anteils der Befragten einer Sache positiv gegenüberstehen, wenn man doch schon während der Hypothesendiskussion, die niemals lange genug aufrechterhalten werden kann, weiß, daß es mehrere sind, ja bestimmt viele, aber niemals alle.
Mir scheint, es müsse endlich ernst gemacht werden mit der Einsicht, daß die Gier, mit Hilfe solcher, der Repräsentativität immer schon nur rätselhaft angehöriger Daten über soziale Gruppen Urteile zu fällen, nichts anderes ist als die alte zerstörerische der Metaphysik, auch da Urteile zu sprechen, wo es gar nicht mehr um die Realität geht, wo um so mehr das Urteil aber als Akt der Willkür, der Ideologie aufs Reale Wirkung zeugt. Es genügt, sich ästhetisch mit dem Fragebogen zu befassen, um sich klar zu werden, daß Daten, die der Reliabilitätsnorm genügen würden, unmöglich zu erhalten sind – zu groß werden die Schwankungen immer gewesen sein, denen das Subjekt im Akt der Ankreuzigung untersteht.
5. Die Grundhypothesen
(zKuMu = zeitgenössische Kunstmusik)
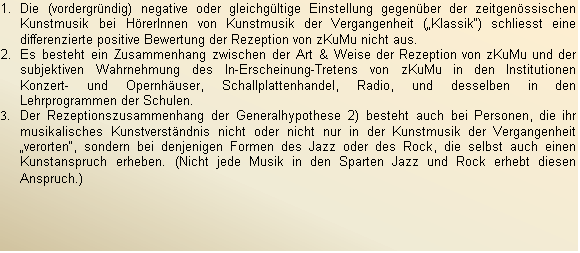
6. Die Hypothesen
(zKuMu = zeitgenössische Kunstmusik)
[In eckigen Klammern sind Entwürfe von Hypothesen angegeben. Dies soll anzeigen, wie sich die Form der Forschungslogik auf den Gehalt auswirkt: Arbeitshypothesen haben immer die Form wenn A dann B oder je mehr A desto mehr B. Nur dadurch sind sie empirisch überprüfbar. Das Maß der Korrelation zwischen den Elementen A und B – der Korrelationskoeffizient – gibt Auskunft über das Allgemeine und Absolute der hypothetisch geäußerten Aussage. Der eine Grenzwert ist das Maß 0. In der Realität ist dieses Verhältnis nicht anzutreffen, da jedes Element der Wirklichkeit mit jedem anderen in Beziehung gebracht werden kann. Der andere Grenzwert ist das Maß 1. Dieses Maß stellt einen absoluten Zusammenhang fest zwischen zwei Elementen: strenge Kausalität oder Identität.]
1 Je analytischer die Hörgewohnheiten, desto stärker ist das Interesse an zeitgenössischer Kunstmusik (zKuMu).
2 Das eigene Praktizieren von Musik fördert das Interesse an zKuMu.
3 Das Praktizieren von improvisierter Musik fördert das Interesse an zKuMu.
4 Je geringer die Kenntnisse von zKuMu, desto stärker wird sie abgelehnt.
5a) Die Ablehnung von zKuMu nimmt zu mit der Ausgeprägtheit der Vorstellung, daß es eine lineare Entwicklung in der Musik nach der Jahrhundertwende gäbe.
b) Die Ablehnung von zKuMu nimmt zu mit der Ausgeprägtheit der Vorstellung, daß die Musik nach der Jahrhundertwende sich parallel entwickle zur Entwicklung des wissenschaftlich-technischen Instrumentariums.
c) Die Ablehnung von zKuMu nimmt zu mit der Ausgeprägtheit der Vorstellung, daß nach der Jahrhundertwende der Sinn aus der Musik entschwinde.
d) Das Interesse an zKuMu nimmt zu, je stärker zeitgebunden die klassische Musik aufgefaßt wird.
[Die Ablehnung von zKuMu nimmt zu mit der Ausgeprägtheit der Vorstellung, es gäbe eine graduelle/lineare Entwicklung in der Musik um die Jahrhundertwende, die parallel verlaufe zur Entwicklung des technischen Instrumentariums. Die avantgardistischen Komponisten nutzten derart die Möglichkeiten der Technik aus, daß jeglicher Sinn aus der Musik verschwindet. Umgekehrt nimmt das Interesse an zKuMu zu, wo die klassische Musik zeitgebunden aufgefaßt wird – aber sie „einem halt einfach am besten gefällt“.]
6 Die Ablehnung von zKuMu nimmt zu mit der Nichthinterfragbarkeit der Vorstellung, der Sinn in der Musik sei an den Puls gebunden (ans Tänzerische, Sinnliche).
7 Wer der Aussage zustimmen kann, daß in der Musik kein Sinn zu entschlüsseln ist, akzeptiert die zKuMu stärker.
8 Mit der zunehmenden Ablehnung der zKuMu geht eine zunehmende Indifferenz einher gegenüber den drei Institutionen Konzertveranstalter/Plattenproduzenten, Radio, Lehrprogrammen in der Schule, im Hinblick auf deren Angebot an zKuMu.
9 Je konservativer die Werthaltung, desto größer ist die Indifferenz gegenüber den drei Institutionen Konzerveranstalter/Plattenproduzenten, Radio, Lehrprogrammen in der Schule, im Hinblick auf deren Angebot an zKuMu.
10 Die Akzeptanz von zKuMu setzt nicht zwingend eine progressive Werthaltung voraus.
11 Indifferenz/Ablehnung gegenüber zKuMu wird überhäufig mit quantitativer und qualitativer Überforderung im Arbeitsleben begründet.
[Die Ablehnung gegenüber der zKuMu nimmt ab mit der Begründung der eigenen Überforderung im Arbeitsleben.]
12 Indifferenz/Ablehnung gegenüber zKuMu wird überhäufig mit der Überforderung durch das moderne Leben begründet.
[Wer das eigene Leben heute als zu schwierig einschätzt, würde bei besseren Lebensumständen diese Musik genießen können.]
13 Wer sagt, das Leben heute sei schwierig und sein eigenes davon ausnimmt, lehnt die zKuMu ab.
14a) Geschichtliches Musikbewußtsein fördert das Interesse an zKuMu. (Für die Vorstudie an Universitäten nicht umgesetzt.)
b) Interesse an mythisierender Literatur zur klassischen Musik verhindert ein Interesse an zKuMu. (Für die Vorstudie an Universitäten nicht umgesetzt.)
15 Nichtkonsumation von zKuMu mit gleichzeitig starkem Interesse an ihr kann auf Gruppendruck zurückgeführt werden. (Hausfrauen würden aus diesem Grund mehr zKuMu konsumieren als ihre Gatten, wenn sie könnten.)
16 Die Ablehnung von zKuMu nimmt zu mit der Haltung, daß Musik grundsätzlich ein soziales Ereignis sei, und der šberzeugung, daß zKuMu zum Denken zwinge und deshalb privaten Charakter habe.
[18 An Vereinen interessierte Personen lehnen zKuMu stark ab, schätzen aber Abonnementskonzerte.]
[19 Wenn die bereits gehörten Werke von zKuMu mehr abwägend als nur negativ oder positiv beurteilt werden, ist der Wunsch nach einer Vielfalt von neuen Werken größer; auch gerade größer dann, wenn die bereits gehörten Werke absolut positiv beurteilt werden.]
20 Je unkritischer die Orientierung gegenüber der klassischen Musik, desto ablehnender die Haltung gegenüber der zKuMu.
21 Das Unvermögen, zum eigenen Kunstverständnis Stellung zu nehmen, verstärkt die Ablehnung der zKuMu.
22 Wo eine improvisationsfreudige Haltung auch im Alltag vorherrscht, besteht eher eine Neigung zu zKuMu.
23 Interesse an improvisierter Musik fördert das Interesse an zKuMu.
25 Je mehr Musik mit Melodie assoziiert wird, desto stärker ist die Ablehnung der zKuMu.
26 Je mehr man auf herkömmliche Strukturen fixiert ist, desto weniger versteht man zKuMu. (Diese Hypothese gilt, auch wenn es noch nie in der Musik etwas zu verstehen gegeben hat – in der Musik kann man nur besser oder schlechter wahrnehmen; und das ist ihr sozialpolitischer Sinn, daß man in ihr lernen kann wahrzunehmen...)
27 Wer in einer Primär- oder Sekundärgruppe zur Auseinandersetzung mit klassischer Musik angehalten worden ist/wird, hat stärkeres Interesse an zKuMu.
7. Der Fragebogen: Randauszählung N = 445
8. Mapping Sentence Musiksoziologie
9. Structuples
|
1 |
a b c1 d1 e f g3 n o1 |
|
2 |
a b c1 d1 e p3 |
|
3 |
a b c1 d1 e p1 |
|
4 |
a b c3 d2 e f1 g1 i1 k2 l2 |
|
5a) |
a b c3 d2 e f3 s1 |
|
5b) |
a b c3 d2 e f1 s2 |
|
5c) |
a b c3 d2 e f q3 r2 s3 |
|
5d) |
a b c1 d1 e f1 g2 s4 |
|
6 |
a b c3 d2 e f1 q4 r2 |
|
7 |
a b c1 d2 e f1 q5 r1 |
|
8 |
a b c3 d2 e f1 g1 h k1 l1 |
|
9 |
f1 g1 h k1 l1 w1 |
|
10 |
a b c1 d2 e f1 w2 |
|
11 |
a b c3 d2 t1 v1 u2 |
|
12 |
a b c3 d2 t1 v3 u2 |
|
13 |
a b c3 d2 t1 v4 u1 |
|
14a) |
a b c1 d1 e f1 g2 i1 k2 l1 s4 |
|
14b) |
a b c1 d1 e f1 g2 i1 k1 n o2 |
|
15 |
a b c2 d1 e f3 g1 h i2 k3 l1 m2 n |
|
16 |
a b c3 d2 e f1 g2 q6 r2 |
|
|
a b c3 d2 e f1 g1 q2 r1 |
|
|
a b c3 d2 e f1 g1 h i3 k1 l2 q7 r2 |
|
20 |
a b c3 d2 e f1 g2 i2 k2 l1 |
|
21 |
a b c3 d2 e f1 q8 |
|
22 |
a b c1 d1 e t2 v3 u1 |
|
23 |
a b c1 d1 e f1 g4 i1 k1 l1 |
|
25 |
a b c3 d2 e f1 q1 r1 |
|
26 |
a b c1 d2 e f1 q1 r2 |
|
27 |
a b c1 d1 e f2 g2 i1 k1 l1 p2 |
Das sind die Structuples der gebildeten Hypothesen 1 bis 27 gemäß der Erscheinungsweise der Elemente der Hypothesen in der Mapping Sentence.
Mithilfe der letzteren ließen sich in unserem Falle ungefähr 300 Facetten-Kombinationen konstruieren. Würden die Structuples noch logisch geordnet, könnten die Abstände sämtlicher Variablen, also sämtlicher Frage-Items relativ zueinander dargestellt werden. Allerdings scheinen die Analyseverfahren heute immer noch mehr versprechen zu wollen als sie tatsächlich durchführen
können.
Zusatz 2000: Obwohl der technizistische Aufwand des Verfahrens mittels Mapping Sentence, Structuples und der angesprochenen bildhaften Analysemomente („Smallest Space Analysis“) leicht ins Lächerliche abgleitet, sind es gerade diese Erfahrungen, die zu den Philosophischen Gedankenbildern geführt haben, wo die rein begrifflichen, also alles andere als empirisch-statistischen Grundmomente philosophiegeschichtlicher Fragestellungen in ihren notwendigen Beziehungen zusammengestellt werden.
10. Ausgewählte Korrelationen
[Wegen Platzmangels gibt es keine Internetversion der ausgewählten Korrelationen.]