
Ø
In der Buchfassung gibt es keine Anmerkungen, sondern Nebentexte wie kleine abgelegene Kulturfelder (Äcker und Wiesen). Fürs Internet praktischer sind die archaischen Fußnoten, zu denen hin und von denen weg man einfach zu springen vermag.
Ø
Die Bilder sind in einer selbständigen Datei gesammelt: Bilder zum Kapitel Geschichte und Struktur.
Wie ist es zu verstehen, daß das Wallis, ein so unbedeutender Flecken in der modernen Weltgesellschaft, zum Objekt der Erkenntnis gemacht werden soll? Woher die Notwendigkeit, großspurig von einem theoretischen Interesse zu sprechen, wenn die praktische Bestimmung dieses geographischen Gebildes doch klar ist, eine Region des Tourismus auf lange Zeit hin zu bleiben? Läßt sich eine überraschend neue Erkenntnis erhoffen, die die Gegebenheiten, die schon bekannt sind, in einem neuen Licht dastehen lassen? Ganz offensichtlich ist weniger die Frage nach dem Erkennenwollen problematisch als das Umgekehrte, in der Weise über den Gegenstand zu sprechen, als ob nur das Aneinanderreihen von Ereignissen und Geschehnissen Prominenter imstande wäre, ihn anders denn sinnlich unmittelbar wahrzunehmen. Denn in dieser Verfinsterung präsentiert sich die große Ansammlung der Literatur über die Geschichte des Wallis: daß da nichts zu erkennen wäre als das bloß Faktische. Es ist dies beileibe keine Literatur, mit der sich zu befassen erkenntnisgewinnend wäre, weil im Bewußtsein einzig ein Widerstand gegen sie sich bildet und eine Abwehr mit der Befürchtung, etwas von dem Falschen möge bei zu intensiver, will heißen schutzloser Lektüre sich aufs eigene Denken transferieren. Man muß methodologisch wohl akzeptieren, daß eine immanente Kritik, die die vorliegenden Texte miteinander ins Gespräch setzen würde, wegen der Erscheinungsweise derselben, die ein Zitieren verwehrt, unmöglich ist. Gerade weil über weite Strecken immanent nicht verfahren werden kann, muß das Gebilde als ein neues Ganzes konzipiert werden, dessen vorstrukturierten Teile noch unvermittelt und wie unbearbeitet dazustehen haben. [1]
Jedes Gebilde kann als ein Ganzes zum Objekt des differierenden und urteilenden Erkennens gemacht werden, sofern es nicht wie die Teile des reinen Naturzusammenhangs außerhalb der produzierten Geschichte situiert werden müßte; im schlimmsten Fall des Ignorierens aller Methodologie läßt sich supplementär immer ein Titel in der Form der „Geschichte eines Sachverhaltes“ konstruieren. Drängt eines wie die Landschaft Wallis zur Darstellung als Objekt der Erkenntnis, wird auf der einen Seite der Wille und der Entschluß vorausgesetzt, es deuten zu wollen, zum anderen die Deutung gegen zwei Tendenzen gesetzt werden müssen, die seit je sich widersprechen, gegen den in der Erkenntnistheorie so genannten Realismus, der begrifflich das Gebilde stilisiert, sei es positiv oder negativ, und gegen den Nominalismus, der es auf die Buchhaltung von Ereignissen reduziert, weil das, was die Dinge zusammenhält, vom nicht weiter erklärbaren Einsatz des Willens, der Kraft oder des Kampfes einzelner beziehungsweise gesellschaftlicher Gruppen abhängt.
Wird ein Sachverhalt verbindlich in seiner Wahrheit erkannt, bedeutet diese für uns, daß der Text selbst wieder, da auch er zur Geschichte gehört, Leerstellen zu binden fähig sein muß, die in der Lektüre, die von neuem den Willen zur Erkenntnis voraussetzt, zu deuten wären – er darf nicht den Eindruck erwecken, es seien in ihm selbst alle Schlüsse gezogen worden oder als sei die Totalität aller möglichen Urteile über das Gebilde, den Gegenstand oder das Phänomen bereits geleistet. Entscheidend in diesem Vorgang ist nicht die Tendenz zur Entschlackung des Informationsgehaltes, die leicht sich zu dem Mißbrauch verführen läßt, über Fakten mutwillig hinwegzugleiten, sondern die Wahrung des Subjektiven – Sperrigen – im Objekt, des Subjektiven, das in seiner gelebten Widersprüchlichkeit eher dann respektiert wird, wenn es im strukturellen Zusammenhang mitunter bloß in der Form der Andeutung behandelt wird statt in der schlecht-unendlichen Reihe der Ereignisse festgekettet.
Man muß folglich zwei Spuren verfolgen: a) die Elemente der Erkenntnis so zusammenfügen, daß die Beschreibungen sichtbar aus dem Horizont der geschichtlichen Reaktion hinausverschoben werden und Raum geschaffen wird für ein kritisches Bewußtsein, in jedem Moment, indem die Begriffe, mittels derer gedeutet wird, als solche für uns gekennzeichnet werden, und b) Anleihen bei Disziplinen machen, deren Erkenntnisgehalte zwar nie so recht in der Geschichte haben Gestalt annehmen können, trotzdem sich ebensowenig haben auflösen lassen – Joder, der wie der Teufel, der von Pratoborno nicht mehr loskam, heute, am 6. August, vor dreißig Jahren, 1969, würde sagen, man muß die Begriffe aus der falschen Departementalisierung, wo sie nur den Weg verstellen, herausklauben und sie so gruppieren, daß Rechte auf Einsicht zustandekommen, die auch praktisch Wirkung zeugen. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen die Begriffe des Naturschönen, mit denen die Seßhaftigkeit der WalliserInnen begründbar wird sowie diejenigen der Topologie beziehungsweise Topographie, die allesamt von den Formationen der Gletscher abhängen und selbst sowohl die soziale wie die ökonomische Reproduktion bestimmen. [2] – Zwei mögliche Fehltritte ins Abseits sind allerdings zu beachten. Erstens nützt es wenig, die Begriffe in ihrem traditionellen Zusammenhang beizubehalten, also ein Kapitel über Klima, Bodenbeschaffenheit etc. formal in den Text einzufügen, weil das Mißverhältnis das kritische Wissen, das allein der Vermittlung entspringt, untergraben würde. Zweitens besteht die Gefahr, mit Begriffen aus entlegenen Disziplinen, insbesondere solchen aus den Naturwissenschaften, in eine unrühmliche Verankerung zu geraten, die die unabdingbare Verflüssigung der gesellschaftstheoretischen sistierte.
So sehr der Wille als Wille zum Erkennen vorausgesetzt wird, so wenig erscheint er als Moment im Objekt der Erkenntnis, weil das Erkennenwollen von komplexen geschichtlichen Gebilden nicht zum geringsten das Ziel verfolgt, allen mythischen Geschlossenheiten zu entkommen, von denen die kaum wirkungslosesten so Widersprüchliches wie das Schicksal, den Willen des Allmächtigen, den Willen zur Macht, die Vernunft als Wille zur Selbstbehauptung, den Trieb oder den Kampf im Zentrum haben. Der Intellektualismus, der sich auf die produktive Kraft der ästhetischen Gebilde einläßt, weil sie sich in der begrifflichen Übersetzung gesellschaftlich koordinieren läßt und vom Diffusen des Ästhetischen überhaupt absetzt, muß keineswegs das Dynamische in der Geschichte ignorieren und diese als bloße Galerie von Bildern präsentieren – denn wären präliminaristisch Varianten des Intellektualismus erst ins Recht gesetzt, weniger als Theorie denn als Konzepte des Arbeitsprozesses (die das Wallis nicht als Domäne des Tourismus, als Gebiet einer unterentwickelten Bergbauernwirtschaft, als Reservat täppischer Volksbräuche und verknorkster Ausdrucksweisen verstehen wollen), würden die Eruptionen, auf denen der Voluntarismus beharrt, weder verleugnet werden müssen noch, wie es die gesellschaftliche Praxis fordert, bis in den letzten Winkel der Regression akklamiert, sondern da zum Zuge gelassen, wo sie die Totalitätsansprüche der Gesellschaft eben zu durchbrechen vermögen statt reaktiv bekräftigen. Wo die Gesellschaft den Wunsch nur dadurch akzeptiert, daß sie ihm unmittelbar das Maul stopft wie die Mutter der Nuckelpinte mit dem Schnuller, um ja keine weiteren Wünsche sich artikulieren zu lassen, wirkt einzig dort das triebhaft Unbedingte noch eisbrechend, wo seine Erfüllung nicht an den Anspruch eines Individuums geheftet erscheint. Weder die Prostitution, zu der nicht die Befreiung führt sondern der willentliche, parteiprogammatische böse Mangel in der Organisation der gesellschaftlichen Arbeit zwingt, und die den Wunsch wie in der Warenwerbung mehr pervertiert statt erfüllt, noch der Kampf müssen dann als Kategorien in einer Theorie herhalten, die sich als moralische versteht oder als praktische der Gesellschaft; im Gegenteil erscheint die Wirkungskraft des Theoretischen da größer, wo ohne sie ausgekommen wird, weil sie doch mehr zum Innersten und zum Kitt der schlechten Gesellschaft gehören statt zur Befreiung aus ihr. Ist eine intellektualistische Haltung positiv vielleicht nicht eindeutig zu umreißen, so klärt sie sich negativ, als dezidierter Antivoluntarismus, der sich gegen die Verklärung richtet a) der nach instantaner Erfüllung brüllenden Triebkraft, b) der sozialen Erscheinungsweise eines Selbstbewußtseins, das allein darin seinen Zweck sieht, dem anderen hämisch mit den Marken der Anerkennung den Boden unter den Füßen heiß zu machen und c) aller Formen des Kampfes – als ob diese Kategorien wie in einem Mythos, von dessen Zwängen die Moderne sich doch effizient lösen will, als wirklichste, unantastbare Wirklichkeit zu gelten hätten.
Die Spurensuche der Anfänge hat zu unterscheiden zwischen der Siedlungsgeschichte der Landschaft Wallis, die fast kein Wissen für uns freizugeben Bereitschaft zeigt, und der Entstehung der Dorfschaften am Ende des ersten christlichen Jahrtausends, die schon zusammenfällt mit der Struktur der Gesamtgesellschaft selbst, dem Feudalismus des Mittelalters. Von einer einheitlichen ursprünglichen Bevölkerung kann deswegen nicht gesprochen werden, weil die ältesten archäologischen Zeugnisse darauf hinweisen, daß Siedlungsgruppen anfänglich über den Großen St. Bernhard und via St-Maurice ins Wallis einwanderten, dann bald auch über die Furka und den Simplon: aus dem östlichen Europa, aus dem nordöstlichen wie dem nordwestlichen Italien und aus dem westlichen Europa. Über genaue Zeitverläufe dieser recht unterschiedlichen Einwanderungsgruppen sowie die denkbaren Beziehungen derselben untereinander ist nichts bekannt. Immerhin lassen sich die räumlichen Siedlungsmöglichkeiten einschränken, wenn man berücksichtigt, wie wild der Wasserlauf des Rottens beziehungsweise der Rhône bis zur großen Korrektion im 19. und 20. Jahrhundert sich gebärdete: nur am Rand des Talbeckens, weit vom eigentlichen Flußufer entfernt, besser noch leicht erhöht ließ sich geschützt vor Überschwemmungen gesellschaftlich leben. Auch den Phantasien über ein ursprüngliches Walliserleben in höheren Gefilden kann dank naturwissenschaftlich-glaziologischen Untersuchungen ein Riegel vorgeschoben werden (Röthlisberger 1976, 134ff): Nachdem die letzte Eiszeit, die nicht etwa zusammen mit den vorangegangenen die Formen der Berge und Täler schuf, sondern an ihnen bloß Oberflächen- und Schleifspuren zurückgelassen hat, ihr eigentliches Ende finden konnte, waren die Gletscherbewegungen, sowohl die Vorstöße wie die Rückzüge, viel zu gering, als daß sich ein ganzjähriges Leben einer intakten Gesellschaft oberhalb der heute besiedelten Zone vorstellen ließe. Doch auch wenn sie gering waren, ermöglichten die Gletscherrückgänge doch, gerechnet über ungefähr 6000 Jahre, ein paar Male die Bildung von Lärchen- beziehungsweise Arvenwäldern in der Höhe bis zu 2550m; da sich solche Wälder, die jeweils während über 200 Jahren der wiedererfolgten Klimaverschlechterung standhielten, nur lokal verfestigten, also niemals das Wallis als Ganzes überdeckten, sind kurzfristige, einzelne Wirtschaftsgemeinschaften, wie sie die Sagen erwähnen, nicht a priori von der Hand zu weisen, insbesondere wenn man sie auf die letzte Wärmeperiode zwischen 1000 und 1450 n. Chr. bezieht (die aber nicht mehr zur ursprünglichen Siedlungsgeschichte gehört). Wie auch immer die Anfänge zu phantasieren wären – nach langen Jahrhunderten der Stein-, Bronze- und Eisenzeiten stoßen um das 5. Jahrhundert v. Chr. Gälen beziehungsweise Kelten zu den alten Gesellschaftsgruppen. Auch bei diesem Prozeß existiert beinahe kein Wissen darüber, wie die verschiedenen Gruppen einander begegneten, wie sie zusammenfanden und wie sie zusammen lebten. Beinahe kein Wissen. Denn es mußte doch so etwas wie eine organisierte Gesamtgesellschaft gewesen sein, die 57. v. Chr. einen ersten Einmarsch der Römer über den Großen St. Bernhard nach Martigny verhinderte. Um die 50 Jahre später meinten die Römer es aber ernst und kolonialisierten das Wallis, das sie über Acaunum/St-Maurice als Durchgang zum Norden brauchten, bis mindestens nach Siders hinauf (ob der Simplon von Brig aus als römischer Paß regelmäßig begangen wurde, scheint nicht gesichert zu sein). Erwägt man, in was für eine Sprachkultur das Lateinische sich hat einschmelzen lassen, so ist es diejenige der ursprünglichen Besiedlung, von der keine sprachlichen Materialien sich so erhalten hätten, daß sich ein Strukturgebilde rekonstruieren ließe – die äußerst geringe Anzahl von Flur- und Geländenamen, die ebenso winzig bleibt unter Berücksichtigung der lateinisierten Zusätze, nötigt zur Annahme, daß nichts von der militaristischen „Kultur“ der Kolonialherren das Wallis des weiteren hypothekarisch hat belasten können (Meyer 1914 und Zimmermann 1968; eine umfassende Separatuntersuchung zur Genese und Struktur der Sprache und Sprachen im Wallis fehlt).
Nachdem das Reich durch den Militarismus selbst, der eine reale Ökonomie sabotierte, gleichzeitig aber die Forderungen nach Steuern ins Unerfüllbare intensivierte, zu zerfallen begann, und als Ende 4. Jahrhundert ein Bischof, wenn auch nur mit bescheidenem Aktionsradius, sich in Martigny als Missionsarbeiter hat installieren können, wanderten um 500 als Burgunder die Provenzalen in die Täler und auf die Hänge des Wallis (vom Westen herkommend bis nach Leuk und ins Leukerbad, dessen warmes Wasser schon in den vorangegangenen Kulturen genutzt worden war), wo sie teils ihren Dialekt bis heute zu verteidigen vermochten, teils dem Französischen nachgaben wie dies in ihren ursprünglichen Herkunftsgebieten vornehmlich im Umfeld der Fürstengeschlechter geschah und bis heute durch Diktat von Paris aus zu geschehen hat. Da über die zweite Hälfte des ersten Jahrtausends fast nichts Dokumentarisches die Geschichte zu überdauern vermochte, kann die Herausbildung der Dorfschaften, die mit der Einwanderung der deutschsprachigen Alemannen über den Grimselpaß im 9. Jahrhundert begann (die Furka führte zwar nach Osten, erst aber mit dem Ausbau des Weges durch die Schöllenen auch in die Zentral- und Nordschweiz), quasi als ein Prozeß außerhalb der Geschichte, jedenfalls recht eigentümlich unabhängig jeglicher Herrschaftsstruktur begriffen werden. Man hat sich dann ohne Hoffnung auf Antwort zu fragen, inwieweit von verschiedenen, eventuell kämpferischen Prozessen gesprochen werden muß, inwieweit umgekehrt das Entstehen der Dörfer nicht bereits schon Prinzipien ihrer Reproduktion gehorcht, so daß die Genese wesentlich mit der Struktur identisch zu werden scheint. [3]
Obwohl in einigen Passagen von Texten mit einer historischen Perspektive darauf gedrängt wird, zwischen der Bauernwirtschaft der französischsprachigen Burgunder und derjenigen der deutschsprachigen Alemannen zu unterscheiden, um die letzteren als eher kollektivistisch orientierte Milchverarbeiter beziehungsweise Viehzüchter darzustellen und die Welschen als in Streusiedlungen vereinzelte Selbstversorger, bei denen nur die Kirche, abgetrennt vom Ökonomischen, ein Dorfschaftsleben herzustellen vermochte, entstehen bis spätestens um die Jahrtausendwende im ganzen Wallis an denjenigen Orten dieselben Dorfgebilde, wie sie auch heute noch bekannt sind (jedenfalls in Form der ältesten Fotografien) – in einer Verteilung und Größe, die ausgewogener nicht sein könnte. Die Parameter, die diesen letzten Besiedlungsprozeß (vor dem tourismusindustriellen des 20. Jahrhunderts) steuerten, sind das Wasservorkommen und eine genügend große Restmenge an Schutzwald, nachdem von ihm für den Ackerbau und die Weide- und Alpwirtschaft eine ausreichend große Fläche gerodet worden war.
Und doch. So interessant, wichtig und richtig es ist, den Prozeß der Dorfbildung als einen eigenständigen losgelöst von irgendwelchen spezifischen Herrschaftsverhältnissen aufzufassen, so ist es doch nur die Organisationsform der Arbeit (Niederer 1965), die außerhalb der Geschichte steht, weil allem Geschehen immer schon ein „schummriges“, undurchschaubares und unüberblickbares Unrechtsverhältnis vorgelagert ist. Obwohl die Dorfstruktur autonom funktioniert, ist sie in ein größeres Gefüge, in die feudale Gesamtgesellschaft eingebunden. Läßt diese Herrschaftsstruktur, die dem jeweils Stärkeren, lauter Brüllenden den Vortritt opfert, überhaupt realitätsnah sich vorstellen? Müßte nicht als erstes die Idee von sich gestoßen werden, es könnten Rechtsverhältnisse herausgearbeitet werden, weil es doch das Unrecht ist, das die Gesellschaft legitimiert? Jedenfalls kann man nicht genügend oft sich zu vergegenwärtigen versuchen, daß alle Besitzverhältnisse im Besitz eines einzelnen, letztlich immer „des“ Königs, ihren Rechtsgrund haben, den dieser „erste Lehensherr“ durch bloße Stimmerhebung als den seinigen zu beanspruchen vermag (hinter den König wird je nach ideologischen Bedürfnissen noch Gott selbst gesetzt, der die Welt für alles Lebendige als bloßes Lehen erscheinen läßt).
Und in einer weiteren Wegkurve ein neues Trotzdem. Auch wenn die Unrechtsverhältnisse schwer lasten mögen, spielen sie in der Ausbildung der Dörfer keine Rolle. Denn alles dreht sich bei der Entstehung der Walliser Kulturlandschaft um die Natur und die Nöte, die von ihr ausgehen. Kein anderer hat dieses Besondere des Wallis mit solcher Prägnanz auf den Begriff gebracht wie der professionell als Ethnologe Tätige Sprachfindling Robert Mc Netting 1981, indem er seinem ausführlichen Werk über Törbel den Titel gab Balancing on an alp. Es ist nicht nur eine große Kunst, versehen mit einem unermesslichen Willen zur Anstrengung, die vorausgesetzt wird, um an den steilen Hängen des Wallis – und sie sind überall steil! – wirtschaftliche Dorfgemeinschaften am Leben zu erhalten, sondern es braucht auch soziale Techniken wie die Heirats- und Erbschaftsregelungen, um die ökonomischen Größen so in der Balance zu halten, daß neben den Katastrophen der Natur nicht noch, durch Unumsichtigkeit gegenüber der Natur, den Produktionsgütern und den Facetten der Reproduktion eigenproduzierte das einzelne Dorfgefüge in Gefahren bringen. [4]
Wie heikel es ist, die Balance zu wahren, zeigt das Phänomen der Walserbewegungen bereits im 12. und 13. Jahrhundert, als aus den deutschsprachigen Gegenden teils einzelne Familien, teils ganze Dorf- und Talverbände einen neuen Wohnsitz außerhalb der Heimat finden mußten: im Lütschinental (bis Grindelwald und auf die Planalp), im Aostatal, im Anzascatal (von Macugnaga [Waibel 1982] bis Ornavasso), im Antigoriotal bis hinüber nach Bosco-Gurin, bei St. Moritz, Davos und Klosters (bis St. Antönien), im Averstal (bis in die Gegend des Piz d‘Err), im Valsertal, im Calfeisen- und Weisstannental, im Liechtensteinischen Saminatal und an vielen Stellen im österreichischen Vorarlberg (Kreis 1966). Zur Einzigartigkeit des Phänomens gehört nicht nur die Landsuche einer besonderen Gruppe verstreut über ein ziemlich großes, der Struktur nach aber einheitliches Berggebiet, sondern quasi auch eine stabile kulturelle Solidarität, die mehrere Jahrhunderte zu überdauern vermochte. Daß nur deutschsprachige Oberwalliser an diesen Wanderzügen teilnahmen, kann daran gelegen haben, daß der Bevölkerungsüberschuß bei den Unterwallisern erst später einsetzte, als Soldaten in fremde Dienste aufgenommen wurden (konkret schon früh in savoyische, wo sie gegen die Oberwalliser kämpfen mußten) oder daran, daß nur deutschsprachige Grundbesitzer Lockangebote machen konnten, weil nur sie noch so viel schlechtes Land – denn immer war es schwierig, wo die WalliserInnen bauerten – zur gewinnbringenden Nutzung freihatten. Ob die Einschränkung der Migrationsbewegung auf die Oberwalliser als Argument dafür genommen werden soll, daß eben doch stark zu unterscheiden wäre zwischen dem Leben im Oberwallis und demjenigen im großen Gebiet zwischen dem Val d‘Anniviers und dem Chablais, scheint übertrieben.
Die Kirche, die wesentlich als eine Mitte zwischen dem Alltag im Dorf und dem Herrschaftssystem zu begreifen ist, braucht nicht, wie man es vielleicht von einer kritischen Soziologie erwartete, negativ dargestellt zu werden, als ob sie alleine dafür verantwortlich wäre, daß ein kritisches Bewußtsein sich nie hat bilden können. Aber obwohl sie durch den verdeckten Kulturanspruch es ist, die es ermöglicht, gewisse Fragen überhaupt erst zu stellen, ist doch sie die Ursache dafür immer schon gewesen, wie heute die Kulturindustrie, daß entscheidende zugeschüttet wurden, die befreiend hätten wirken können, indem sie die Vermittlung zwischen der Arbeit und der Herrschaft in die bewußte Sprache geführt hätten. Zur Anschauung dafür, wie die Kirche Fragen zuschüttet, hat man für einmal in einen Katechismus hinein zu schauen, für viele im Wallis das einzige Textgefüge, das sie sich zeitlebens, am Anfang mündlich, seit ungefähr 1800 auch lesend zu Gemüte führten (die Hausbibel mag gesehen werden als quasi eine Erfindung der Reformation, auf die der schriftliche Katechismus die Reaktion ist). Der Text, als Ganzes keineswegs lang, ist in allen zugezogenen Ausgaben in einem kindlichen Frage-Antwortspiel festgebunden. In dieser Passage stellt er klar, was es mit Kritik Schlechtes auf sich hat (Canisius 1997, 59): „Frage: Wie sündigt man wider den Glauben? Antwort: Wenn man an die Offenbarung Gottes gar nicht glaubt, oder sie nicht ganz glaubt; wenn man zweifelt, ob diese oder jene Lehre der katholischen Kirche wahr sei; wenn man den Glauben verleugnet, oder sich der Gefahr aussetzt, denselben zu verlieren.“ Eine zünftige Kritik wird schnell lächerlicher als das Kritisierte selbst, als Widerschein des reformatorischen Willens zum Besserwissen, weil der Kirche die Aufgabe der Vermittlung nur schlecht bekommt. So haarsträubend die katechetische Antwort erscheint, weil sie das Denken verteufelt, so wahrhaftig und redlich funktioniert sie im System der Kirche. Dadurch daß der Kategorienapparat, der ihr zur Verfügung steht, so winzig klein ist, erschlafft im Nu alle Anstrengung zur Vermittlung in einem täppischen fort–da, worin sie zwar eine unendliche Freude am Unendlichen zu entwickeln vermag, dessen Momente der Repräsentation aber nie mit denen des Präsenten in einem weiteren Sinn als dem des kindlichen Spielens vergleichen will, kritisch. Die Kirche sagt, die Wahrheit und das Gute sind da, und daran wollen wir uns halten, um selbst ein gutes Leben zu führen und zu haben, aber zugleich sagt sie auch, die Wahrheit und das Gute sind fort, und nur die Kirche ist da, weswegen ihr nicht bloß an den einen Gott zu glauben habt, sondern mehr noch an die Art und Weise, wie die Kirche es für richtig hält. Weil es eben ein Spiel ist, Gott wegzuschicken, fort–da, kann die Kirche so bitter ernst die Seite der Herrschaft für sich in Anspruch nehmen, zu sein und gar die Mitte zu sein, ohne vermitteln zu wollen.
Über die Ursprünge und ersten Schritte zur Entwicklung der Walliser Missionierung scheint kein Material verfügbar zu sein. Man muß deshalb die begriffliche Spekulation so anordnen, daß zwei Tendenzen auf gleiche Weise betont werden können, a) die Entfaltung des Systematischen der Kirche und b) der phänomenale Kontext eines Lebens, das in seiner permanenten Erschütterung durch den Tod insbesondere während der notwendigen, also alltäglichen Arbeit sich in einem entscheidenden Maße von dem in anderen Berggebieten unterscheidet. Dieser Tod, der nur in sehr schwierigem Gelände, das während des ganzen Jahreslaufes mit Höllentücken plagt, sein Unwesen treibt, ist es, der eine nicht zu verbergende Melancholie aufs Leben legt und den Wunsch nach einer gewissen sinnlich spürbaren Präsenz der Kirche erzeugt, der nun nicht mehr unbedingt innerhalb der Frage des Glaubens und der Gläubigkeit der einzelnen zu erläutern ist, sondern wesentlich eben mit der Besonderheit des Todes korrespondiert, die die schöne Landschaft als Tribut zu verlangen scheint.
Es fragt sich als erstes, wie weit sich der Horizont der Bildung der Priester und Pfarrleute spannte, die die Totalität des Kulturellen an den Tag legen mußten und, noch heute, zu verantworten haben. Der Kleriker des Mittelalters hat nie jemals etwas darüber hinaus zu lernen bekommen als das brave Lesen und Schreiben. Ist das ein Grund, seine Ausbildung und Bildung zu bespotten und ihn in seiner intellektuellen Kompetenz geringzuschätzen? Keineswegs, wenn man bedenkt, wie heute der Philosoph zuweilen nur lernen darf, philosophische Texte zu lesen und tunlichst es zu unterlassen hat, sie untereinander und zur Gegenwart in einen kritischen Bezug zu setzen; wenn man bedenkt, wie das Mädchen der Soziologie darauf konditioniert wird, der Dreistigkeit und damit der Regression freien Lauf zu lassen, den unbedarften Befragungsmassen mit nipperlischen Fragen das Mikrophon schlüpfrig vors Gesicht zu halten und in Publikationen von nichts anderem als der Größe des eigenen Fragemuts zu schwärmen; wenn man bedenkt, daß in der maezenatisch unterfütterten Musikwissenschaft es einspruchslos geschehen kann, daß Kompositionsentwürfe des Pariser Maître der Serialität, Materialien also von äußerster Brisanz, so geistlos ineinanderverschachtelt auf den Tisch gelegt werden, daß ein Leser selbst bei ausgesprochen fanatischem Willen keine Deutung mehr vorzunehmen vermag, weil die Präsentation sich aufdrängt wie ein Würfelwurf des großen New Yorker Postseriellen (avant la lettre) – dann entspricht das anerkannte, also praktisch verwertbare Wissen des mittelalterlich-neuzeitlichen Walliser Klerus in nur wenigem nicht der Praxis der zeitgenössischen Intellektuellen. Diese drei hergehuschten Beispiele der aktuellen positivistischen Bewußtseinslage korrespondieren deswegen so reibungslos mit der intellektuellen Bedürftigkeit des alten Walliser Klerus, weil dessen Diskursmedium, das geerbte Latein, an einen Doppelcharakter gebunden ist, einerseits als Sprache genutzt zu werden, die alle Schranken der Lokalsprachlichkeit überspringt, andererseits, durch die doppelte Konzeption des frühchristlichen Gottes, in seiner Allmächtigkeit dem Leben sowohl bejahend wie kasteiend gegenüberzustehen, das Wissen vom gehorsamen Volk fernzuhalten: erst in der zensurumspannten Tolerierung der Philosophie nach 1600 mit Descartes erscheint auch um 1700 bei Leibniz in der Zeit der Reformation der allwissende Gott mit dem Verständnis oder Bild des Menschen, dem das Recht auf Einsicht ins Wissen zu gewähren sei. Genau dieses Projekt der Aufklärung scheint scheitern zu müssen, weil deren Akteure mit der Genügsamkeit derjenigen liebäugeln, die sie spontan doch als Unwissende bezeichnen würden – die aber vielleicht weniger aus Mangel an Wissen im Zwielicht stehen sondern simpel wegen der zu großen Bereitwilligkeit, das Systematische der Kirche als die Wirklichkeit selbst verteidigen zu wollen. [5]
Im permanenten Scheitern der Aufklärung machen der Positivismus, schlechte Kunst und unvermittelte Metaphysik die Kultur kalt. Solcher Kälte trotzt subversiv das formlose sich Äußern der Bauern, indem es vor jeder Erklärung abbricht: –. Der Bauer von heute verstummt, wo die Buchhaltung des Positivisten anhebt und frivol die schlechten Verhältnisse durch Erklärungen verklärt und sanktioniert wie der Bauer von einst verstummte, weil nur dem Pfarrer im Dorf das Wort zu sprechen gegeben war. Der Wissenschaftler der Kultur, der sich den Wertungen enthoben wähnt, spricht eine Welt heilig, die nur im Falschen erscheint. Das Schweigen der Bauern, das diesen bösen Schein subvertiert, führte indes nie zu einer Kritik, weil es in realen Verhältnissen geschieht (das Schweigen ist Handeln), die keine Vermittlungspotentiale enthalten; aber es erscheint uns, gänzlich ohne Pathos, als etwas altes Menschliches, das handfest ein gutes Leben verspricht, weil es zu dem nicht Ja sagt, das zusätzlich zur Wirklichkeit Anerkennung beansprucht.
Auf der Systemebene steht dieser Deutung des Schweigens entgegen, daß in gewisser Weise im Wallis von einem Doppelcharakter der Religion zu sprechen ist, weil sie einerseits die Absorptionsinstanz alles Künstlerischen bildet, unvermittelt und getrennt gegenüber dem Naturzwang, andererseits die vielgestaltige Opfertätigkeit stark an primitive Gesellschaften erinnert, wodurch das Religiöse und der religiöse Kult gänzlich in den Naturzwang eingelassen sind beziehungsweise ihrerseits von demselben absorbiert werden. Der Unterschied zum primitiven Opfer besteht im Gelöbnis, das ihm vorausgeht und das weniger im Opfer terminieren sollte als in einer festen Bindung an die Kirche. Diese inszeniert dann und begünstigt das Opfer, um die Gläubigen formbar zu machen. Es gibt eine Verknüpfung des Opfers mit der Unterordnung des Individuums in der Masse bei den Prozessionen, die auch zu Massenprozessionen auswachsen konnten. Solche bilden leicht einmal den Kitt für das sich unterordnende Bewußtsein, in dem das Schweigen mehr dem Ersticken gleicht als dem Zurückhalten überzeugender Rede. [6]
Eine besondere Form des Opferns geschieht während des 18. Jahrhunderts, indem sie ein Stück weit von der Reliquienverehrung zehrt, die zur Zeit der Gegenreformation, nach 1600, von der katholischen Kirche enorm intensiviert worden war (es wurden die römischen Katakomben durch Einzelstücke und ganze Gerippe regelrecht geplündert): die Opferpraxis des Ex Voto, aus einem Gelübde. In der Waldkapelle von Ernen hängen knapp über 10 Ex Votos aus den Jahren 1695 bis 1977 (das jüngste fällt deswegen aus dem Rahmen, weil seit Ende des 18. Jahrhunderts die Tradition der Ex Voto Opfergabe nicht weitergeführt wurde). Die Bilder, die sonst nur aus Anderegg 1979 bekannt sind, entfalten auch heute eine erstaunlich große Wirkung, von einem malerischen Dilettantismus ist kaum etwas zu spüren.
Zwischen den Ex Votos, die ein gewisses pekuniäres Vermögen voraussetzen, und dem mythischen Opferwillen stehen die Bruderschaften und die Armenspend, die nicht selten ihren Grund in einem Gelübde während den Pestzeiten haben (die Pest hat zu keiner Zeit das ganze Wallis lahmgelegt, sondern beherrschte jeweils einzelne Dörfer, die abzudichten offenbar nicht unmöglich war): was im Ex Voto sich auf einzelne bezieht, ist in den Bruderschaften dörfliche Institution gewesen. [7]
Da die Reliquienverehrung unermeßlich viel Einfühlungsvermögen voraussetzt, wenn sie verstanden werden soll, seien hier nur die Namen der Verehrten aufgelistet, wie sie einem im Wallis begegnen und Rätsel über Rätsel aufgeben können (Gruber 1932). Die Heiligen figurieren als eine Art Vorstand für Kirchen, Kapellen, Altäre, Benefizien, Spenden, Spitäler und Bruderschaften; an einigen Stellen oder Anlässen figurieren mehrere. Normalerweise entstammen die Heiligen der gesamtkirchlichen Tradition, einige sind typisch Walliserisch, einige aus fremden Bezirken.
a) Allgemeinkirchliche Kulte: Maria, Johannes der Täufer, Johannes der Evangelist, Petrus, Paulus, Andreas, Michael, Klemens, Urban, Marzellus, Silvester, Gregor, Stephan, Laurentius, Vincentius, Pankraz, Hippolyt, Georg, Fabian, Sebastian, Agnes, Euphemia, Unschuldige Kinder, Martin, Dreifaltigkeit, Heiliges Kreuz, Fronleichnam, Heiliger Geist, Jacobus Maior, Bartholomäus, Markus, Nikolaus, Katharina, Maria Magdalena, Antonius der Einsiedler, Triphon, Blasius, Pantaleon, Christophorus, Zehntausend Märtyrer, Petronilla, Margareta, Barbara, Dorothea, Apollonia, Ursula, Apollinaris, Augustinus, Hieronymus, Benedictus, Franziskus, Alexius, Anna, Allerheiligen, Allerseelen.
b) Walliser Kulte: Mauritius und Gefährten, Viktor Märtyrer, Theodor (Theodull, Joder), Sigismund, Bernhard von Menthon, Silvius, Severin.
c) Fremde Lokalkulte: Genesius, Bonifatius, Romanus, Hilarius, Eusebius von Vercelli, Desiderius von Langres, Germanus von Auxerre, Symphorian, Germanus von Paris, Leodegar, Gallus, Leonhard, Theobald, Eligius, Sulpitius Pius, Claudius, Gotthard, Dreikönige, Gratus, Wilhelm von Neuenburg, Karl der Grosse.
Das Erdrückende der Liste verführt zur Unterstellung eines umfassenden Aberglaubens in der paradiesischen Landschaft. Dieses Vorurteil wäre zu korrigieren. Denn da die Art der Glaubenskundgabe institutionell organisiert ist, kann sie die Tendenz der Übersättigung, als das Gegenteil des Aberglaubens, nur mit Schwierigkeiten von sich fernhalten. Und in der Tat wurden einige Male Vorstöße von Bauern beim Bischof getätigt, um gegen das Anwachsen der Anzahl von Feiertagen Einspruch zu erheben, weil die extensive Wirtschaft gar nicht bewältigt werden kann, wenn an immer weniger Tagen nur noch gearbeitet werden darf. In einer solchen Zwickmühle, die das quantitative Maß des Glaubens nur mit Mühe in Balance hält, wundert es wenig, daß der Aberglaube leicht auch in Selbstironie hinüberzuwechseln vermag.
Dann also der zahlenverquere Titel, die sieben Zehnden. Was der Begriff Zehnden ursprünglich meint, ist nicht gänzlich eindeutig herzuleiten, obwohl die Sache, Teil des ganzen Wallis zu sein, klar ist. Als solcher Teil könnte man ihn verstehen als Bezirk mit relativ eigenständiger Verwaltung, mit eigenem Zehnten, mit eigenen Steuern. Der Begriff des Zehnden meint so einen Bezirk, der sich selbst verwaltet und bei dem das Verständnis beziehungsweise der Anspruch des Eigenen mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann; das demokratische Wallis der sieben Zehnden hebt sich dann in seinem Selbstverständnis bewußt vom fürstbischöflichen feudalen ab. Eine zweite Herleitung ist basispolitisch indifferent und meint, es hätten sich zufällig zehn größere Gebiete im Wallis ergeben, die alle aus Gemeindeverbänden bestanden und auch die diesbezügliche Bezeichnung „Contractus“ benutzten, wie sie heute noch für das Gebiet zwischen Sierre und Montana als Noble Contrée verwendet wird. Zu den sieben Contractus Goms, östlich/westlich Raron, Brig, Visp, Leuk, Sierre und Sion sind dann noch die drei im mehr oder weniger stark von den Savoyern beanspruchten Gebiet angesiedelten Großgemeinden Chamoson/Ardon (eine Landschaft, die weder geographisch noch kulturell mit Savoyen konnotiert werden kann), Martigny und Massongex (bei Monthey) anzuführen. Die offizielle Geschichtsschreibung des Walliser Erziehungsdepartements erläutert einigermaßen chaotisch in einer dritten Variante: „Zenden. (Herkunft ungeklärt, lateinisch Centena = Hundertschaft = Unterteilung der Grafschaft?; lateinisch decima = Zehntbezirk? zehnter Teil der bischöflichen Herrschaft?): politische Einheit der Landschaft Wallis“ etc. (Fibicher 1993, 440; zur Ungelöstheit der Zehndenfrage auch Carlen 1982, 40, Anm. 2)
Für die Genese der Zehndengesellschaft sind zwei Ereignisphasen bedeutsam, die eine, um 1400, läßt sie entstehen, indem sie die Feudalgewalten massiv in die Knie zwingt, die zweite, nicht minder blutige um 1500, läßt sie sich festigen. [8]
a) Wie Truffer 1971 umfassenderweise darstellt, erproben die Walliser am Ende des 14. Jahrhundert zum ersten Mal die direkte Demokratie für die ganze Landschaft (die Arbeitsweise in den Dörfern mittels Gemeinwerk darf mit Fug und Recht als basisdemokratisches Leben begriffen werden). Nachdem sie den savoyardischen Bischof Eduard gestürzt hatten, errichteten sie den demokratischen Landrat, in dem nun nicht nur kein Savoyer mehr das Sagen hatte, sondern auch kaum mehr ein oberwalliser Großadeliger, weil diese bereits ein paar Jahre früher durch die Hartnäckigkeit der Walliser Bevölkerung ans Ende ihres Wirkens gekommen waren – mit Ausnahme der Herren von Raron. Mit diesen, die immer schon mit den Bernern liiert waren, verbündete sich der Graf von Savoyen, um nun aufs heftigste zurückzuschlagen. Das 15. Jahrhundert ist nun ganz geprägt von diesen Bewegungen: einmal die Erfahrung der Demokratie, dann der Rückschlag, dann erneut eine Befreiung usw.
b) Um 1500 beherrschen zwei Gommer Haudegen die Bühne der Walliser Geschichte, die die Bauern mehrmals in miserable, nicht durchzustehende Schlachten trieben, sie also gleichwohl verrieten, wie immer man das Wirken dieser monströsen Gestalten deuten will. Denn wie die beiden, der Kastellan, Offizier und Politiker Jürg Auf der Flüe beziehungsweise Georg Supersaxo und der Bischof und Kardinal Matthäus Schiner zu deuten sind, scheint von der Konfession des Deutenden abzuhängen. War bis vor ein paar Dutzend Jahren auch der Bischof kritisch dargestellt worden, als einer, der wie sein Widersacher der Machtgier verfallen war, so ist von Oberwalliser Seite her heute nur noch Affirmatives über den Kirchenmann zu lesen, im Verein mit einer gewissen Aggressivität gegen kritische Stimmen. Ein solche sei hier genannt, Walter Schmid 1955 (ein Buch, das man nicht unbedingt mit diesem abschreckenden Titel Komm mit mir… hätte versehen müssen). Der vermögende Militärmensch Supersaxo verhalf dem um 10 Jahre jüngeren Schiner, der vom selben Ort, Ernen-Mühlebach herstammt und dessen Onkel bereits als Bischof amtete, zu seiner Karriere. Recht schnell wurden sie zu den denkbar unnachgiebigsten Feinden, die jeweils um die Masse der Bevölkerung buhlten, weil der eine auf die Karte Frankreichs setzte, das dem anderen, dem papsttreuen Bischof als Greuel galt, weswegen er lieber das ganze Land verheizte als seine Zunge, die offenbar gefürchtet war, durch Hören auf Argumente in Zaum zu halten. Es scheint, als wäre ein distanzierter Aufriß dieser schlachtenreichen Zeit immer noch schwierig herzustellen; jedenfalls ist man erleichtert zu sehen, wie nach dem kriegerischen Inferno das Land aufs demokratische Leben sich zu besinnen begann, gestört nur durch sporadisches Wüten der Pest in den einzelnen Dörfern (deren Einwohnerzahlen allerdings schnell einmal sich bis auf zehn Prozent hinunter verkleinerten, wodurch die Überlebenden unverhofft zu einem gewissen Reichtum kamen, den sie seinerseits, korrespondierend mit dem Zeitgeist der Gegenreformation, zum Bauen und Ausbauen neuer Kirchen und Kapellen verwendeten).

Man hat sich die Akteure dieser spannungsgeladenen Geschehnisse ordentlich zu vergegenwärtigen. Die Wahl des Bischofs als dem Vertreter des Papstes und dem Vorsteher einer Diözese, von denen das ganze Wallis gerade eine bildet, war immer schon und scheint es auch heute noch zu sein: eine undurchsichtige Angelegenheit, von der nicht einmal der Grund zur Undurchsichtigkeit begreifbar wäre. Der Walliser Bischof, der kraft eines königlichen Dekrets seit 999 auch fürstlicher, d. h. militärischer Verwalter der Landschaft war [9] , konnte sowohl von oberwalliserischer Herkunft sein wie von unterwalliserischer, savoyischer, italienischer oder gar von weiter entfernter. Da sich das westlich gelegene Savoyen gegenüber dem Wallis verhiehlt wie Habsburg gegenüber der Innerschweiz, war die Lage immer dann besonders explosiv, wenn ein Savoyer Kleriker im Wallis den Sitz des Fürstbischofs innehatte. Nicht zu unterschätzen sind aber auch die im Oberwallis tätigen Adeligen wie die von Turm in Niedergesteln, die Biandrates (Rizzi 1985) oder die von Raron, die das Land nicht durchwegs in Frieden zu halten gewillt waren, wenn der Bischof aus einer ihrer Familien stammend dieses Amt verwaltete. Falsch wäre die Meinung, das Domkapitel sei dem Bischof, dem es die Verwaltung doch erleichtern sollte, stets zu Diensten gewesen. Gerade weil die Besetzung des höchsten Amtes durch die Herkunft des Bischof immer problematisch war, gab das Personal des Domkapitels, das niemals als Ganzes von derselben geographischen Herkunft sein konnte, mit Wucht Gegensteuer. Da die drei Machtinstanzen Fürstbischof, Großadel und Domkapitel gemäß ihrer Herkunft, aber auch ihrer sonstigen, also unberechenbaren Interesselagen verschiedenen Bündnissen entweder verpflichtet waren oder sich verpflichtet fühlten, ist es leicht sich vorzustellen, daß das Land der Bevölkerung schnell einmal mehr als Schlachtbank erschien denn als fruchtbare Wohnstätte. Seit Ende 14. Jahrhundert die ersten Durchbrüche Richtung Demokratie erfolgreich waren, durchzieht die Geschichte der ganzen Landschaft die Idee der Selbstbestimmung, wie sie anscheinend nur in der Innerschweiz noch so entschieden sich hat verankern können. (Man muß vielleicht ein wenig wegkommen von der verdinglichenden Aussage, im Wallis lebe halt ein freiheitsliebendes Volk, was doch immer nur dazu dient, militaristischen Programmen Schützenhilfe zu bieten; es tut der Ehre der Bevölkerung keinen Abbruch, wenn die präzisen Momente bestimmt werden, die als Ursache zur Ingangsetzung selbstbestimmender, demokratischer Prozesse eben auch zu nennen sind. Ein anderes Volk, das ähnlichen Zerstörungstendenzen hätte widerstehen müssen, hätte ähnliche Anzeichen eines Freiheitsdranges an den Tag gelegt.)
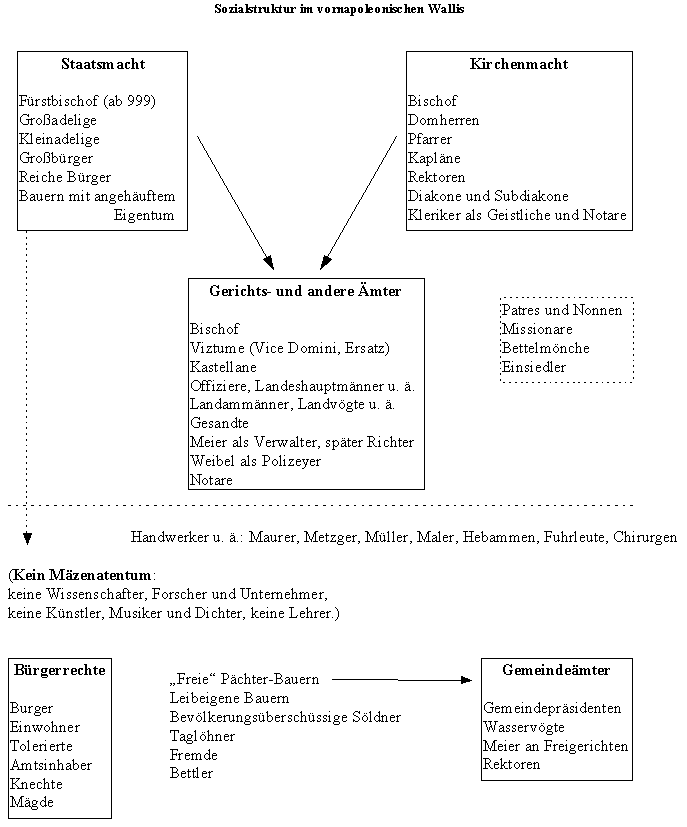
Die zwei Schemata zu den Momenten der Dynamik und der Struktur der Walliser Geschichte sollen das Bild einer einfachen Alpengesellschaft zu vermitteln helfen. Es zeigen sich recht viele Hierarchieebenen, die alle den einen Zweck verfolgen, auf Gerichtsbarkeiten Zugriff zu haben. Die Walliser Zehndengesellschaft präsentiert nach der Vertreibung der Savoyer Kriegsbeamtenschaft [10] als Gebiete 1 Diözese mit sieben Zehnden und zwei Vogteien (als den eigentlichen Untertanengebieten der Oberwalliser von Conthey bis St-Gingolph) mit den Institutionen der Zehndenarmeen, der Gerichte, der Genossenschaften fürs Gemeinwerk (Alpen, Wege, Wald, Wasser und meistens auch Wein), der Burgerschaften, der Pfarreien, der Bruderschaften und der Familien mit endogener Heiratstendenz. Auf dem Platz der Dörfer regelt der Bodenbesitz drei Arten der wohnrechtlichen Zugehörigkeit: a) der stimmberechtigten Burger (communiers), b) der Einwohner mit bloßem Aufenthaltsrecht (tolérés oder habitants) und c) der nicht im Dorf ansäßigen Besitzenden (terrementiers). Jeder Mensch, heimisch, nicht heimisch oder Ausländer, kann zu Bodenbesitz gelangen, normalerweise durch die im Wallis eigentümliche Erbschaft mittels Güterteilung (die jedem Erben ein Minimum guten Bodens garantiert), durch Heirat, die nur dann profitabel ist, wenn beide im selben Dorf erben können (tendenziell eben endogam), aber auch durch Kauf. Das Burgerrecht wird normalerweise ererbt, kann an einem neuen Ort aber auch erworben werden, wenn genügend Besitz vorgewiesen werden kann, eine Geldsumme abgegeben und ein Gemeindeeid geschworen wird. Umgekehrt gilt, daß einer, der eine gewisse Menge Bodenbesitz erworben hat und schon eine gewisse Zeit am Ort lebt, das Burgerrecht erwerben muß, wenn er vom Gemeindenutzen (dem Holz aus dem Wald und der Allmend für die Tiere) nicht ausgeschlossen werden soll. Wo die Ortschaften auch bei winziger Kleinheit von einer eigenen Gemeinde sprechen, ist es schnell möglich, daß Familien in mehreren Dörfern Burger sind.
Als Walliser Besonderheit gelten die sechs Freigerichte Wald oder Eggen bei Simplon (ab 1400), Gehren (ab 1405), Finnen, Ganter, Holz und Steg, die dadurch entstanden sind, daß ein Dorf, das einem Feudalherren gehört, von diesem, der das Geld einbringende, aber doch zuwenig lukrative Richtamt innehat, dasselbe abkaufte. Weit gefehlt wäre die
Annahme, ein Dorf, das seinen Richter in die Wüste schickt, würde auch die Institution der Polizey und des Gerichts auf den Misthaufen der Geschichte karren! Da es immer den Argwohn gibt, der Nachbar, der kaum zwei Meter weit entfernt wohnt, könnte bei den Mistgeschäften leicht dem eigenen Mist auch fremden aufsetzen, braucht es eine
Instanz, die solche Zwistigkeiten schlichtet, unter der Devise, lieber ein Fehlurteil mehr, das gegen einen selbst sich richtet, als die quälende Ungewißheit, das andere Dorffamilienmitglied sei durch Tricks besser begütert als man selbst. Da an den genannten Orten die Bauern allein im Wechsel von zwei Jahren das Richteramt auszuführen hatten, entsteht der Eindruck, es wären an den
Stätten der Freigerichte immer nur Lappalien verhandelt worden, und die Urteile könnten, da man mit den Verurteilten das Leben im Dorf weiter zu führen hatte, kaum je recht hart gewesen sein. Jossen 1988 erwähnt indessen ein Dokument, nachdem der Munder Meier (= Richter) in Finnen, Lorenz Carlen, am 8. 11. 1796 Josef Huotter und Sohn von Gorb zum Tod durch Hängen verurteilt, wegen
Diebstahls. (Grauenhafte Zeugnisse auch an den amtlichen Gerichtsstätten, insbesondere im Rahmen des auch im Wallis tobenden Hexenwahns, enthält Arnold 1961.)
Und dennoch, soll die Zehndengesellschaft nicht wenigstens der Tendenz nach als eine verstanden werden, in der alle, die ein Amt innehaben, dieses so verwalten, wie dessen Zweckbestimmung, die nichts anderem dient als der Ermöglichung der Entfaltung einer freien Gesellschaft im Alpenraum, es verlangt? Dubois 1965 zeigt minuziös, wie der Landrat die Vertragsverhältnisse immer wieder von neuem sicherstellte, so daß namentlich der Salzhandel ins Wallis gesichert blieb. Es entsteht in diesem äußerst wertvollen Buch über die Walliser Zehndengesellschaft leicht der Eindruck, die Herrschaft sei tatsächlich Bedienstete der Allgemeinheit. Doch ab und zu blitzt das Reale des Herrschens durch, die eigenen Privilegien à tout prix aufrecht zu erhalten. Anmerkung 26 Seite 181 ist eine der raren Stellen, wo darauf hingewiesen wird, wie der Landrat, also die Versammlung der Zehnden, die trotz Vertreibung der mittelalterlichen Freiherren fast gänzlich von Großbürgern und Adeligen belegt war, die Gemeinden, also die Organisationsform der produktiven Bevölkerung, „nicht immer sehr objektiv über wichtige Angelegenheiten informierte“.
Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts, die oft als eine besonders ruhige Zeit beschrieben wird, weil die Zehndengesellschaft es offenbar verstanden hat, sich den nicht enden wollenden Kriegen in Gesamteuropa zu entziehen, ist geprägt durch zwei Phänomene: die Gegenreformation und das Wirken Stockalpers. Da die Institution der Kirche durch die Möglichkeit des quasi-profanen Sündenerlasses, der einerseits die böse Ideologie der Sünde und der Schuld zu einer rigiden Diskursformation, der kein Einzelgedanke zu enthuschen vermag, verdichtete und andererseits die religiöse Tat zur tölpelhaften ökonomischen Handlung verkommen ließ, in eine unkontrollierbare Erosion geriet, faßten die Ideen der Reformation auch im Wallis Boden bis in die Gemächer des Domkapitels und des Bischofs selbst. Lange Zeit war die Situation offen, so daß sich unter der reicheren Schicht eine einheitliche Gruppe zu formieren vermochte, die sowohl Schulbildung genossen hat in der Außerschweiz wie auch eindeutig Stellung nahm für die Reformation. Weil die Gesamtbevölkerung noch von keinem Schulobligatorium hat profitieren können, aber sowohl durch die Pestereignisse wie durch die Erfahrung des fragwürdigen Verhaltens der Kirchenleute empfänglich für Kirchenfragen geworden war, blieb das Wallis in der Richtung unentschieden. 1604 wurden die Kapuziner ins Land geholt und die Reformierten von den politischen Ämtern weggedrängt; sozusagen im Gegenzug verzichtet 1634 der Bischof auf alle weltlichen Hoheitsrechte. Erst 1655 wurde entschieden, daß alle Protestanten das Land zu verlassen hätten, und als ab 1662 von den Jesuiten theologische Seminare in Brig abgehalten wurden, war der Kurs eindeutig festgelegt. Da durch die Pestzüge bis ins 17. Jahrhundert nicht nur in einigen Dörfern die Bevölkerung äußerst stark reduziert worden war (1611, 1613, 1616, 1617, 1627, 1628), sondern die Überlebenden teilweise dadurch auch reich geworden sind, waren sowohl die materiellen wie ideologischen Voraussetzungen gegeben, die Wirkungsweise des gegenreformatorischen Katholizismus in Gang zu setzen: durch neue Pfarreien mit neu zu bauenden Kirchen, durch Reliquienimporte aus den römischen Katakomben, durch Kapellenbauten.
Ob Kaspar Jodok von Stockalper (1609–1691, ab 1674 im Exil), der reichste Walliser mit Burgerrecht in 40 Gemeinden, als ein Produkt der Gegenreformation oder als ein unabhängiges paralleles Phänomen zu begreifen ist, läßt sich nicht entscheiden. Die umtriebige Handelstätigkeit, insbesondere in Sachen Salz, das alle Alpengesellschaften importieren mußten (für die menschliche Ernährung und die der Haustiere unerlässlich, ebenso wichtig zur Käseherstellung und Fleischkonservierung: französisches Meersalz aus der Gegend der Rhônemündung, sizilianisches und milanesisches aus Italien, zeitweilig auch solches aus Österreich) und die verbissene Investitions-tätigkeit in Grundbesitz, der kontinuierliche Zinsen garantiert (und dessen erste Käufe möglich waren wegen einer recht großen Erbschaft), sind Anzeichen einer calvinistischen Orientierung – ob es andererseits dem auf gute Beziehungen angewiesenen Kaufmann, Offizier und Staatspolitiker zugute kam, wenn ein Teil der statusähnlichen Bevölkerung, der erst noch mit den kulturellen Kapitalien zu hantieren weiß, in die Wüste geschickt wird, ist kaum auf einen Punkt bringend abzuwägen. [11] Die Literatur aber behauptet: daß im arbeitenden Volk zu keiner Zeit ein Ressentiment gegen Stockalper erwachsen wäre, weil er den Bauern die überschüssigen Söhne im Söldnerdienst entsorgte und den Übriggebliebenen die Gelegenheit bot, durch sporadisches Lohnarbeiten entweder zu Bargeld zu kommen oder überrissene Käufe, und das waren sie natürlich alle, abzahlen zu können.
Gestürzt wurde Stockalper also nicht durch eine Mißstimmung in der Bevölkerung, sondern allein durch Akte des Adels im Landrat; diese Oberschicht, die eben noch nicht den Habitus oder Sozialcharakter des „Unternehmers“ zu prästieren vermochte, sondern die mageren Einkünfte immer noch nur über Pachtzinsen erlangte, stand letztlich durch ein gewisses Selbstverschulden gegenüber Stockalper arm da. [12] Nachdem dieser also von seinen persönlichen Gegnern durch eine Art Palastrevolte entmachtet und in Brig unter Hausarrest gestellt worden war, konnte er, allein und ohne die Familienangehörigen, über den Simplon nach Domodossola fliehen. Nun kommt es zu einer formellen Anklage mit über dreißig juristischen Vorwürfen; der erste widmet sich der Macht- und Raffgier. Dem katholischen Pfarrer Arnold (1972) gelingt eine Darstellung der Motive und Abläufe dieses sozialen Gesamtprozesses Ende der siebziger Jahre im 17. Jahrhundert, die einen stark glauben macht, die Ankläger Stockalpers stünden in keiner Weise mehr im Kontakt mit den wirklichen Verhältnissen. Es scheint ganz so, als wären ihre Motive einzig persönliches Ressentiment – und als ob keine Bauernschaft unter der Abhängigkeit von Stockalper zu leiden gehabt hätte, sondern umgekehrt durch persönliche freundschaftliche Bindung nur um so mehr bereit gewesen wäre, für ihren Herrn das Ganze herzugeben. – Dem Lesenden fehlt es an Möglichkeiten, die Einschätzungen Arnolds, die bezüglich der ideologischen Formation des Oberwallis nicht ignoriert werden dürfen, abzuwägen.
Wie leicht nur würde das Wallis anders dastehen, wenn der gigantische Finanzaristokrat als interessierter Mäzen sich in Szene gesetzt hätte. Nichts hindert daran, die Landschaft sich zu phantasieren in großer Blütenpracht hinsichtlich aller erdenklicher Künste. Denn dieselben entfalten sich weniger da, wo ein Volk schon hat künstlerische Fähigkeiten unter Beweis stellen können, sondern einzig in solchen Ökonomien, wo ein gewisser Mehrwert bereits hat abgeschöpft werden können, der durch die Eigentümlichkeit der Herrschaftsstruktur weder in die Wirtschaft hat zurückfließen noch gesellschaftlich-allgemein vernichtet werden müssen – sondern aus freien Stücken quasi in die Tätigkeit solcher Gesellschaftsgruppen hat investiert werden können, die im Dispositiv der Künste sich zu bewähren anschicken. [13]
Nach dem Rückzug der Franzosen 1815, die nach fast zwanzig Jahren teils direkter, teils objektiv aber auch eher wenig unangenehmer Fremdherrschaft im Bewußtsein des katholischen Wallis schwelende Wunden hinterließen, änderte sich, soweit keine technischen Neuerungen in die Landschaft Einzug hielten, im Alltag der Bergbauern wenig. Zu diesem Wenigen gehören aber doch eine politische Reform und eine soziokulturelle Quasi-Errungenschaft. Mit dem ersten ist an die Ersetzung der güterfixierten kommunitären Burgerschaften durch die geldfixierten fiskalischen Bürgergemeinden zu denken, mit dem zweiten an die Vereine. Von diesen ist der eine offen zivil-militaristisch: der Schießverein, der unumwunden in den Statuten seiner Ableger in den einzelnen Dörfern – und knallen wollen sie überall! – die Franzosen erwähnt und klar zum Ausdruck bringt, daß man wegen ihnen sich im Wehren zu üben hätte. Der andere enthält, vielleicht etwas gewundener, in seinen Zweckartikeln kaum weniger fragwürdige Motive: der Blasmusikverein hat als höchstes Ziel die Wahrung eines Ethos – das im Ton perfekt mit den aktuellen Schulprogrammen harmoniert, die alle Musik zur Turnübung abwürgen – mit beliebiger Austauschbarkeit vis-à-vis demjenigen der Schießvereine. Da wegen des Fehlens einer Arbeiterklasse keine innerwalliserische ideologische Konkurrenz zwischen den Vereinen sich hat entwickeln können, sind in dieser Landschaft die Vereinsstatuten ein konkretes materielles Moment der Reaktion, Bestandteil eines Diskursgefüges, das unverhohlen den kritischen Gedanken ächtet, indem es als Vereinszwecke die Pflege nennt der Einstellung gegen die anarchistischen Ideen der französischen Revolution, für die Tradition, gegen die Reformation, für die Kirche, für das Militär etc. [14]
Bezüglich des modernen Wallis sind zwei Punkte erwägenswert, die von einer Dialektik des Undialektischen, des Unvermittelbaren-Unvermittelnden sprechen lassen; der eine ist zu lokalisieren auf der Systemebene, der andere in der Lebenswelt. Wie hätte man vom kritischen Bewußtsein zu sprechen heute?
a) Es ist zu fragen, ob in der neusten Zeit im Kanton Anstrengungen getätigt werden, den Mechanismus der gesellschaftlichen Vermittlung in Schwung zu bringen. Obwohl man hervorheben darf, daß eine ordentliche Anzahl von Dissertationen mit Walliser Herkunft geschrieben werden, daß eine Anlaufstelle für die Fernuniversität Hagen eingerichtet wurde und daß Planungsarbeiten in verschiedene Richtungen getätigt werden, erscheinen auch jetzt noch die Aktivitäten vonseiten der Verwaltung und der Regierung aufgesetzt, weil in sich selbst nicht vermittelt. Was den Geschehnissen fehlt, sind Impulse der Anstrengung, die ernst zu nehmen wären, weil sie als Weiteres dastünden denn als bloße Werbeaktionen der Staatsverwaltung.
b) Es gibt im Wallis immer die Aussage, der Walliser sei kritisch und aufmüpfig, deswegen stecke er, und man spricht dann ausnahmslos in dieser mythisierenden Form, in Schwierigkeiten. Doch erscheint im Beobachten einzelner Ereignisse des Widerständigen doch bloß wieder etwas Altbekanntes Ruppiges, weil sich im Gang der Geschichte die wesenhafte Unvermittelheit soweit im Sozialcharakter hat sedimentieren können, daß die Kritik im Verhalten sich gänzlich zur starren Abwehr verpanzert und so neuerdings die Kraft der Unvermitteltheit auch im Alltagsverhalten von Grund auf, vom einzelnen her, speist. Was zu beobachten wäre ist, wie der Rebell sich gegen die kritische Vernünftigkeit wehrt, gegen das noch nicht Gewisse, damit er sich um so ungehemmter einer Autorität unterwerfen kann, dem irrationalen Glauben. Doch betrifft dies ausschließlich diejenige Situation, wo beharrlich davon gesprochen wird, der Walliser und die Walliserin seien deshalb den TouristInnen ein Kuriosum und ein Wunderding, weil sie vom kritischen Trotz nicht lassen könnten. Der Sozialcharakter des trotzigen Rebellen erscheint nur im vereinzelten Individuum, bildet mitnichten eine Ganzheit wie die „Mentalität der WalliserInnen“. [15]
Zusatz: Struktur und Infrastruktur
Es verwundert, weshalb bei so vielen Aufenthalten im Wallis der Eindruck entsteht, das Flair einer alten Gesellschaft sei samt und sonders untergegangen, eigentlich bewege man sich in einem Etwas, das mit dem schönen Namen Wallis, der von Naturgestalten spricht, nicht mehr bezeichnet werden dürfte. Allerdings macht es ordentlich Mühe, einen triftigen Grund dafür anzugeben, da man nur zu schnell über die Phrase stolpert, es hätte allenthalben zu viele TouristInnen: Weder sind sie auf den gegangenen Wegen anzutreffen gewesen, noch stört ihre Erscheinung nach ernsthaftem Eingedenken. Ebenso gibt es zuhauf Einzelbegegnungen mit WalliserInnen, die typische Phänomene des alten, exotischen Wallis repräsentieren. [16]
Das Problem versteckt sich also in einem anderen Feld – nicht auf dem der harten Einzelfakten, sondern dem der Struktur. Wie beim alten philosophischen Begriff des Wesens geht es auch beim Begriff der Struktur darum, die erkenntnistheoretische Schwierigkeit des Unterscheidens zwischen wahrem Sein und scheinhaftem Erscheinen beziehungsweise Meinen systematisch in Rücksicht zu nehmen, mit der Neuerung, daß die Momente des zu erfassenden Gebildes nicht in ihrem Sein, sondern in ihren dynamischen Beziehungen und Verhältnissen beschrieben werden; dieselben können sehr einfach sein, aber auch komplex. Ganz eigentümlich sind die Folgen des Komplexitätsproblems beim Wesensbegriff: Obzwar die Totalität eines Gebildes oder Phänomens nicht erkannt werden kann, muß die Totalität als kritische im Prozeß der Darstellung der Erkenntnis ohne Unterlaß zur Sprache kommen, im Sinne des Ganzen, das, wegen der Gewalt, die die Menschen einander antun, falsch erscheint. [17] Das Totalitätsproblem, recht eigentlich die Hölle der Metaphysik, weil es sie erzwingt (indem es einen fortlaufend von schönen Wesen sprechen läßt) und im gleichen Zug falsch macht (die kritische Totalität ist nur mit Anstrengung in den begrifflichen Diskurs hineinzuschmuggeln, weil sie alles andere fragwürdig, sozusagen mit Schuldgefühlen dastehen macht), durchzieht auch den Strukturbegriff. Denn wenn die Struktur strukturiert, also in anonymer Weise die Momente der Beziehungen organisiert, kann kaum mit Fug der Frage ausgewichen werden, wie die Struktur selbst denn strukturiert wird – als ob es nicht etwas gebe, letztlich eine Urstruktur, auf welche sie sich reduzieren ließe. Solange man sich aber nur mit Einzelfragen abgibt und diese deutlich ihre Strukturbeziehungen erscheinen lassen, ist die Frage wenig drängend. Das alte Wallis in seinen Strukturmomenten darzustellen, bietet keine Schwierigkeiten:
· Die Tendenz zur Endogamie, die durch einen Blick ins Telefonbuch von heute bestätigt wird, hat bestimmte ökonomisch-topographische Voraussetzungen und führt, mit der Erbgüterteilung, zur Aufsplitterung des Boden- und Hausbesitzes in äußerst geringe Teile (die ein Schreiben herausfordert, das der Intention nach sie und die Wegfindung zu den Gütern spiegelt). Wenn Mann und Frau ihre Erbstücke im selben Dorf zusammenlegen, ergibt sich schneller eine produktive Gesamtheit als wenn der eine Teil Güter am alten Ort verkaufen müßte, um neuerdings damit Güter am Ort des Ehelebens zu kaufen.
· Die beeindruckenden Wege, Wasserleiten, Alpnutzungen, die Waldpflege und Weinkultur haben ihren Grund im Gemeinwerk mit der Betonung der Lebensfreude und der Verspottung falscher Identitäten, die nicht mit der Landschaft korrespondieren.
· Es wird eine große Vielfalt an kirchlicher Zeichengebung praktiziert; verständlich wird dies, wenn gesehen wird, wie der Tod das Leben prägt, weil er zu oft nur während der Arbeit erscheint. (Es sagt die unsichtbare Stimme auf der Wasserleite: „Die Stunde ist da, der Mann noch nicht.“)
· Die eisigen, kaum in einer Struktur wahrnehmbaren Kunstverhältnisse zeugen von schändlichen Herrschaften ledig aller mäzenatischer Impulse.
· Es gibt im Schweizer Kanton Wallis der Nachfranzosenzeit, als Grenzfall zum alten Wallis, das seltsame Phänomen der Parteienaufteilung in den klassenidentischen Dörfern als mehr oder weniger bissige Tradition und Folklore: sie spielt mit dem rebellischen Charakter der Bergbauern, der mangels Artikulationsdispositivs nur zu gerne einer undurchschaubaren Machtformation seine Stimme gibt.

Die einzelnen Strukturgebilde lassen sich mühelos in die Landschaft reintegrieren, von der sie, als dem Ganzen, dessen Teile bilden. Die analytische Strukturierung eines Gebildes hat also den Zweck, so von den Dingen zu sprechen, daß sie in ihrem Zusammenhang erkannt werden, den sie selbst mitbilden, mitstrukturieren. Genau diese Korrspondenz ist es, die heute zerstört wird. Es lassen sich zwar immer noch Einzelphänomene so begreifen, daß sie in ihrem Zusammenhang erkennbar werden; was aber zerstört worden ist, erfährt man als den größeren Gesamtzusammenhang selbst: diejenige Struktur, die es möglich machte, daß in jedem Einzelphänomen das ganze Wallis erscheinen konnte. Heute erscheint die instrumentelle Infrastruktur wie die Struktur, weil sie alles überdeckt. Es existiert einzig der Abhub der Verwertungsinteressen, nota bene immer nur die Logik des Subjektivismus der Kapitalinvestitionen. [18]
[zum Inhaltsverzeichnis]
[1]
Die Publikationen der Walliser Geschichte werden sowohl pauschal zurückgewiesen wie zur unabdingbaren Voraussetzung gemacht, zum Teil auch mit recht großer Bewunderung eingesetzt, weil sie einen ökonomischen Umgang mit den Archivalien erlauben. Der Plan, eine kritische, totalisierende Geschichte der
Vermittlung der letzteren mit den Publikationen zu schreiben, ist schon mehrmals, auch von amtlicher Seite her angekündigt worden; seine Realisation wird aber weniger entscheidende Erkenntnisse bereitstellen als vielmehr die alten Vorurteile hinter Nebelschwaden lockend flunkern lassen, weil sie anstelle der „Erfahrung mit dem Wallis selbst“ nur solche mit den abgesetzten Archiven
zur Bedingung hat, die zur Entscheidung vieler Fragen die Materialien gar nicht bereitzustellen imstande sind. Nichtsdestotrotz müßte, wenigstens in Teilbereichen, das alte Unternehmen getätigt werden, weil die Voraussetzungen, die es neu schaffen wird, auch ohne Bewältigung der Vorurteile, als ganze immer kritische sein werden.
[2]
Gletschersoziologie ist der vorläufige Name für dieses Vorgehen, das wohl nicht verallgemeinert werden kann, weil nicht alle Gegenden der bewohnten Welt solch paradiesische Attraktionen bereitzustellen vermögen wie das Wallis, das andererseits gerade
deswegen dem Allgemeinen nicht ausweicht, weil mehr oder weniger unverhofft die normativen Potentiale zentrale Verhaltensweisen der „modernen“ Gesellschaft, die die Kulturindustrie verlangt und die mit der schlechten Unendlichkeit des Unverbindlichen korrespondieren, aufmunternd und aggressionsfrei als überlebte erscheinen lassen.
[3]
Die Passagen in den Geschichtsbüchern, die so gern von den kriegerischen Franken, den kriegerischen Alemannen etc. sprechen, dienen nur dem Zweck, die institutionalisierte Gewalt des Militärischen der Gegenwart zu sanktionieren – über nachvollziehbare kriegerische Beziehungen nämlich ist nichts bekannt.
Umgekehrt steht der einzelne heute den Katastrophen gegenüber, die die Menschen an allen Orten der Welt einander antun, wie der mythische Mensch den Katastrophen der Natur gegenüber einst. Man muß es aber immer wieder sagen, daß jene immensen gesellschaftlich organisierten Gewaltakte nicht in der Natur des Menschen liegen, sondern allein im militaristischen Moment der tief im
Verborgenen operierenden Metaphysik, gegen das eine Revolte gesellschaftlich noch nie zu verspüren war.
[4]
Die Wiesenstücke, die durch die Suonen erst ermöglicht wurden, erscheinen als winzig; im Bau der Wasserleiten realisiert sich eine ungeheure Anstrengung für eine Winzigkeit. Doch führt die Wanderung, in der alle Absicht der Soziologie einer Berggesellschaft ihre Voraussetzung hat, einmal Mitte Juni durch die
steilen Hänge des Lötschbergs, wo doch die scheinbare Kleinheit der bewässerten Felder am augenfälligsten wäre, stehen zuerst einzelne im halbmeterhohen Blumenland, die es schneiden, dann die gesamte Bevölkerung mit allen möglichen Zusätzen, die das Heu wendet und schließlich einbringt. Zu sehen ist das Land nun in einer schier unermesslichen Fülle. Plötzlich erscheinen die
Matten mitnichten als Moment einer kargen Überlebensweise, sondern als rationaler Teil einer maßvollen Ökonomie, mit dem auch heute zu rechnen wäre. Die Totale der alten Walliser Ökonomie ist von diesem Phänomen her, das im Jahreslauf nur kurz aufleuchtet, so zu charakterisieren, daß sie nicht nur dem Anwachsen der Dorfschaftsbevölkerung eine strenge Limite setzt, sondern auch,
zwecks Verwaltung des Reichtums, ebenso streng eine minimale an Mitarbeitenden voraussetzt.
Eine existentielle Erfahrung in der mythischen Gesellschaft ist die Angst vor der Unberechenbarkeit und dem katastrophischen Charakter der Natur. Das Opfer, das getan wird, um einen Zweck zu realisieren (Besänftigung der Naturgewalten, Begünstigung der Fruchtbarkeit), gibt diesem Zusammenhang Sinn: Wir Menschen, die wir opfern, gehören zusammen, weil wir im gleichen Ausmaß
von den Unwirtlichkeiten betroffen sind, die wir beeinflussen zu können hoffen. Die Religionen derjenigen Gesellschaften, die sich vom Mythos lösen (ohne eine Ablösung leisten zu können), machen den Bezug des Opfers zur Zweckrationalität obsolet; im Zentrum des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs steht nun nicht mehr eine existentielle Erfahrung, sondern eine vernünftige
Deutung des Lebens und eine Deutung vis–à–vis dem Tode überhaupt (selbstredend nicht innerhalb der Grenzen der Vernunft), die solange überleben kann, als eine Verbindlichkeit im Leben Anerkennung findet.
Weil das Selbstopfer des Gottessohnes nicht für dasjenige steht, das ein individuelles Selbst bildet, sondern radikal alle Formen des Opferns in sich hineinzieht, sind die Opferhandlungen während den kirchlichen Messen, die nach wie vor von den mythischen abzuleiten sind, keine in irgendeiner Form von diesen, sondern nie ans Ende gelangende mahnende Erinnerungen an die Opfertat
als Bekenntnisse des Glaubens. Und da diese Form des Opfers jeden Zweck ausschließt, entsteht ein freier Handlungsraum, der die Opfergabe für andere zuläßt, als Armenspend, ohne – wenigstens der ursprünglichen Intention nach – für sich selbst etwas gewinnen zu wollen. Obwohl das religiöse Opfer immer schon losgekoppelt war vom Schein der Zweckrationalität, hat die
diskursive Vernunft, die doch bereits 400 Jahre vor Geburt der christlichen Religion mit Sokrates & Platon feste Formen hat annehmen können, wenn auch innerhalb einer rigide vom Mythos und der Sklavenschinderei beherrschten Gesellschaft, bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts warten müssen, um offiziell gesellschaftlich tolerierbar zu werden. Denn das Verbindliche in den großen
Religionen liegt nicht in den gemeinschaftlichen Feiern, in den symbolischen Messeopfern oder in einer ursprünglichen Opferung beziehungsweise Offenbarung, auch nicht im abwesenden Heiligen, sondern in der Vermittlung des Heiligen: in den Sakramenten. Sie nehmen den Unmündigen durch die Taufe in die Gemeinschaft auf, lassen ihn seinen Glauben in der Konfirmation bestätigen, geben
der Reproduktion Form sei es im Bund der Ehe oder im zölibatären Gelübde der Priesterweihe und steigern, wie hilflos auch immer, den Sinn des Lebens, indem sie auch den Prozeß des Sterbens zu ihrer Sache machen. Als Akte einer Institution sind sie aber eben abhängig von der gesellschaftlichen Organisation und dem gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang, der Herrschaft; das
Verbindliche, das in der mythischen Gesellschaft aus einer Erfahrung entspringt, untersteht in den Gesellschaften der großen Religionen den Verläufen der Geschichte. Wie immer die Vermittlungsformen der katholischen Kirche im Wallis einen fruchtbaren Boden haben vorfinden können, weil die historischen Tendenzen der Aufklärung auf flüssigere Verkehrsverhältnisse sowie
durchlässigere hierarchische Gesellschaftszusammensetzungen angewiesen waren, sind auch für sie historische Grenzen abzusehen. Löst sich denn aber nicht überhaupt in den „modernen“ Gesellschaften das Verbindliche der Alten „allgemein“ auf, indem mit der Durchsichtigkeit der Funktionsweise der Wirtschafts- und Rechtssysteme, wie scheinhaft gut rational auch immer, und dem
Miteinbezug des freien, verantwortlichen Willens der einzelnen in dem Vollzug des demokratischen Meinungsbildungsprozesses mehr als ein gültiger Ersatz erwachsen war?
Längst vor dem Zerfall der gesellschaftlichen Bedeutung der Großreligionen befolgen die Produktionen der Musik Gebote der Verbindlichkeit, weil auch sie ein Versprechen geben wollen. Während die Verbindlichkeit im Umkreis der Kulturindustrie zerfällt wie alles auch Nichtmusikalische, das dem Warenfetisch nicht widersteht, zeichnet sich die serielle Musik dadurch aus, daß sie am Glücksversprechen, das in der autonomen klassischen Musik sich verdichtete, festhält, indem sie sein ideologisches Moment, daß die Realisierung des Individuellen – des melodietrunkenen Themas – auch zur guten Verwirklichung des Ganzen führt, innerhalb der Domäne der Musik bis in die letzten Winkel auseinandernimmt. Wie das spätere Analysefragment zeigt, ist nicht wenig vom Charakter dieser Musik, auch dies, daß sie in ihrer Totalität nicht zu begreifen ist, weil das Versprechen aufs Glück, zu dem das bewußte Leben immer drängt, falsch wäre, zwar nicht im geringsten in der Gesellschaft des Wallis aufgehoben, nichtsdestoweniger in die Vielfalt seiner Landschaft hineingeschrieben. Wie auch immer der Zerfall der Religion auf die Gesellschaft sich auswirken mag (schlecht ist nur dasjenige Leben, das sich zwar äußern will, aber vor allem Beginnen immer schon den regressiven Zwängen des Unverbindlichen nachgegeben hat) – das Entscheidende, die Idee der Verbindlichkeit, die mit der ursprünglichen Sinnstiftung des Opferns in großem Maße korrespondiert und entschieden das Fahrige der Kulturindustrie von sich weist, läßt in der komplexen Landschaft des Wallis auch fürderhin sich nachvollziehen.
[6]
Die Sage spricht von einem Ereignis, als am selben Tag bei Ernen eine große Gruppe aus dem oberen Goms eine Prozession machte wie eine noch größere aus dem Ober- und Mittelwallis. Da plötzlich die Kinder der zwei verschiedenen Prozessionsverbände einander in die Haare gerieten, wurde nachgefragt: die
Prozession der Gommer wurde abgehalten, um dem Regen ein Ende zu machen, die der anderen, um ihn endlich herbeizuführen. Es braucht nicht des näheren ausgemalt zu werden, wie nun auch die Erwachsenen der beiden Prozessionen einander die Köpfe einzuschlagen begannen.
[7]
Die Armenspend ist deswegen schwierig zu begreifen, weil in keinem Text plausibel gemacht wird, wie denn die Armen an den übrigen 350 Tagen sich ernährt haben, wenn die Spende in einem Dorf beispielsweise 15 mal pro Jahr getätigt wurde. Vielleicht hatte sie immer schon mehr einen symbolischen mahnenden
Charakter wie die Bruderschaften, und so wie dieselben als eine Art Bank handfest Geldwerte zu verleihen vermochten, stand die ganze Gemeinschaft in Notfällen einzelner oder von Gruppen helfend zu Seite, weil sie durch die Institution der Armenspend die Idee des Beistands und der Hilfe immer im Gedächtnis behalten hat. Völlig auf Abwege geriete das schöne Vorurteil, eine arme
Bevölkerungsschicht hätte gesamtgesellschaftlich mit einer fürsorgerischen Betreuung rechnen dürfen. Aufschlußreich und beängstigend schreibt Carlen 1976, 557f mit einem Zitat: „1614 beschloß die Tagsatzung, auf den 14. März dieses Jahres, eine allgemeine Jagd auf das unnütze Volk, starke Bettler, ‚verjagte unnütze Schulmeister, Zigginer und Ryffiöner (?)‘, um sie auf
die Galeeren, vornehmlich die französischen zu verschicken.“
[8]
Feudalistisches Erbe in der föderalistischen Demokratie.
Das Unrechtsverhältnis des Lehenswesens einerseits, die Tatsache also, daß durch willkürliche Gabe, letztlich durchs Königsgeschenk, einer über Grund und Boden verfügt, auf dem alles Leben ihm Zinsen schuldet, und die dörfliche Organisation der Arbeit im Gemeinwesen andererseits führen bei der
Entstehung der Zehndengesellschaft, der Landschaft des Wallis mit der Selbstvorstellung der Demokratie, zu seltsamen Gebilden:
a) Zwischen das Goms und den Bezirk Brig quetscht sich ein ziemlich kleiner Halbbezirk mit dem Namen Östlich-Raron (und den Dörfern Bitsch, Mörel, Blatten und Grengiols), der erst mit der anderen Hälfte Westlich-Raron ein Ganzes bildet; die Luftdistanz zwischen beiden Teilen, die nicht nur durch Brig, sondern auch noch durch Visp voneinander ferngehalten werden, beträgt zehn
Kilometer. Das schwierige Durchgangsgelände Östlich-Raron war seit langem Exklave der Savoyer Grafschaft (was den französischen Ortsnamen Grengiols = grange = Scheuer zu verstehen hilft), Westlich-Raron gehörte den Herren von Raron. Als die Zehndengesellschaft sich durch den Mazzenaufstand gegen den Bischof Eduard von Savoyen zu formieren begann, organisierte sie mit der
Zerschlagung aller Savoyischer Herrschaftsgebiete, die ideologisch-militärisch mit denen der Herren von Raron identisch waren, dieselben als Untertanengebiete. Nicht nur das ganze Wallis unterhalb Sitten wurde ab ungefähr 1500 Untertanengebiet der Oberwalliser, sondern auch einzelne auf dem Gebiet des Oberwallis selbst: das Lötschental, die Schattenberge unterm Augstbordhorn und die
Schluchtendörfer am Rotten ob Naters mußten neu auf die Stimmen von Raron hören, auf die sie demokratisch, sofern der ökonomische Hintergrund es erlaubte, Einfluß nehmen konnten (die Abhängigkeitsprobleme betrafen den militärischen Bereich, beschränkten sich also aufs Verbot für die Lötscher, eine eigene Fahne an die Schießübungen mitzubringen).
b) Für das Leben im Dorf und auf der Alp spielt es keine Rolle, welchen Herren oder Institutionen der Zins abzuliefern ist, weil keine Medien die Zugehörigkeit zu irgendeinem Kasperle-Präsidenten ideologisch relevant machen will. Fast zu schön anarchisch erscheinen uns die Folgen, daß einzelne Bürger gleichzeitig in verschiedenen Gemeinden Burgerrecht haben; daß einzelne
Dörfer ihre kirchliche und politische Gemeindezugehörigkeit nicht nur geographisch weit auseinander gelegen haben, sondern selbst in verschiedenen Zehnden; daß einzelne Dörfer dieselben Zugehörigkeiten wechseln, als ob sie ihnen überhaupt entschlüpfen wollten.
[9]
Es wurde schon erwähnt, wie dem umfassenden Herrscher, dem König, eine militaristische Ruhezone verschafft wird, indem der Klerus als Verwalter einer Landschaft eingesetzt wird; denn durch das biologische Wegfallen des Erbrechts entfallen auch die Erbstreitigkeiten, die zu gefährlichen, unüberschaubaren
Bündnissen auf sozial tieferen Ebenen führen, letztlich aber doch die Herrschaft selbst zu erodieren drohen.
[10]
In der Zehndengesellschaft wird das Französisch dezidiert auf seine Plätze verwiesen, die Orte von Loèche bis Martigny erhalten deutsche Namen: Leuk, Siders, Venten, Brämis, Sitten, Gundis, Martinach
und andere eher komische Ortsnamen haben jetzt Rechtsgültigkeit.
[11] „Stockalper zog aus dem Soldunternehmen im gesamten einen Reingewinn von etwa 250‘000 Pfund. Ein gewöhnlicher Söldner hätte 15‘000 Jahre Dienst tun müssen, um einen solchen Betrag zu verdienen.“ (Steffen 1975, 207)
[12]
„Die Zahl der Verpfändungen an Stockalper ist erschreckend hoch. In einem gewissen Sinn hat sich Stockalper dadurch, dass er überall Grundstücke aufkaufte und damit kleine Leute von ihrem Grund und Boden vertrieb, selbst ein gewisses Söldnerpotential geschaffen.“ (Steffen 1975, 237)
[13]
War Stockalper auch nie ein Mäzen im 17. Jahrhundert, so rettete der letzte Sproß dieser Familie, mit dem sie ausstarb, in der Weise die Ehre im 20. Jahrhundert, daß er sich medizinisch betätigte, nun zwar immer noch keine Künstler fördernd, wohlgesonnen aber beistand der Instandstellung Gebrechlicher, die
nicht zögern im Willen, seine Herkunftsgesellschaft kritisch auf den Begriff zu bringen.
[14]
Der Franzosenterror, der zu grauenhaften Schlachten und zum Auslöschen ganzer Dörfer führte (Chandolin bei Savièse, Unterems, Mund, teilweise Visperterminen, Grengiols etc.) und mindestens im Talgrund alle Haushalte zur Versorgung der Truppen bis
auf den letzten Käse ausraubte, darf nicht banalisiert werden, als ob die Walliser Bauern unzeitgemäß gegen Windmühlen gekämpft hätten. Aber es muß doch erwähnt sein, daß die östlichen Regionen oberhalb Brig, wo die helfenden Österreicher in Stellung waren, unter den Abgabepflichten im gleichen Ausmaß zu leiden hatten und daß
die Franzosen, neben der Auflösung irrationaler Feudalansprüche und deren Integration in eine Steuerverwaltung mit Allgemeinnutzen auch Neuerungen einführten, die im Anschluß daran niemand mehr missen mochte. Zu denken ist an die Medizin (Kämpfen o. J.), insbesondere an die Jodabgabe (Whymper 1990, 369), die offenbar bereits in einer Zeit erfolgte, als die Ursachen der
Kropfbildung und des Kretinismus noch nicht bekannt waren, die Auswaschung der Böden durch die Gletscher derart, daß gewisse Mineralien in den Früchten des Ackerbaus sich nicht mehr zu binden vermochten (Bayard 1977, Merke 1971 und 1973). Die Kropfhälse, am häufigsten im Raum Sion-Martigny, wo die Gletscher schwerer lasteten, erholten sich bei langen Aufenthalten in der Höhe, auf
den Mäien-sässen und den Alpen. Der Kretinismus war in der Erscheinung des Geburtskrüppels die Extremform der Schilddrüsenerkrankung, die häufigere gewöhnliche Kropfbildung konnte auch erst am Anfang oder im Verlauf der Pubertät einsetzen. Sie erscheint eher als ein ästhetisches Kuriosum als eine physische oder psychische Behinderung.
[15]
Die Transformation des rebellischen Charakters geht in der kalten Gesellschaft heute dahin, nur dort noch Sympathie kundzutun, wo sie sich, entgegen allen alten Regeln der Freundschaft, auf einen bereits Anerkannten beziehen kann. Die Ausdifferenzierung der Wirtschafts- und Rechtssysteme im Neokapitalismus am
Ende des 20. Jahrhunderts kolonialisiert nicht bloß die Lebenswelten als Aktionshorizonte der Individuen und sozialen Kleingruppen, sondern reißt zwischen dieselben tiefe Gräben wie nach Erderschütterungen, die immer mehr die Statusfelder so voneinander abtrennen, daß die Erfahrungen ganz unten solchen in Statusbereichen mit höherem Prestige nicht mehr vermittelbar scheinen. Das
Prinzip der Anerkennung, das nur solange funktioniert als es Knechte an Herren bindet, also immer den einen Beziehungs- oder Vertragspartner über den anderen stellt, hat nun vollends sich durchgesetzt, indem es, statt auf die Struktur der Gesellschaft sich zu beschränken, auch die persönlichen Beziehungen strukturiert. Besteht der falsche Mechanismus im rebellischen Charakter in der
Identifikation mit dem Aggressor statt der durchgängigen Kritik an der usurpatorischen Macht, fixiert sich in den persönlichen Beziehungen heute das Bewußtsein aufs verdinglichte Prestige, um der Person desto skrupelloser unverbindlich begegnen zu können.
[16]
Die Behauptung trifft keineswegs zu, die bäuerliche Bevölkerung hätte die Landschaft und die Landwirtschaft im Stich gelassen, denn nur sporadisch entdeckt man Felder, die verganden, und als Beispiel bewundernswerter Standfestigkeit darf berichtet werden, wie am Fuß des Gersthorns es die Bevölkerung war,
die einen Waffenplatz verhinderte, die das Projekt für ein zweites Montana auf die Gletscher schickte und die, bis heute jedenfalls, auf eine Straße verzichtet, die Mund via Kastler mit Eggerberg verbinden würde und die einmal mehr nur dumpfen Sonntagsverkehr hervorzubringen vermöchte (Jossen 1988).
[17]
Die Idee der reinen, nominalistischen Wissenschaftlichkeit stemmt sich gegen die Anstrengung des Totalisierens, um desto vornehmer beziehungsweise distanzierter gegenüber den Ansprüchen auf Verantwortlichkeit die Welt der Erscheinungen und Meinungen in einer unendlichen, unüberblickbaren, aber
um nichts weniger gewissenhaften und korrekten Buchhaltung aufzuzeichnen.
[18]
Man muß überhaupt im Wallis eher davon ausgehen, daß es infrastrukturell versorgt worden ist – eingedeckt wie mit fast neuester Mode ein Vertriebener, dem man einen guten neuen Start wünscht – als daß es sich entwickelt hätte oder entwickelt worden wäre.
[zum Inhaltsverzeichnis]