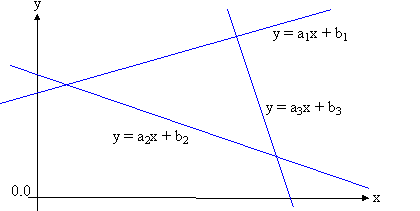
Zu einem guten Buch über Leibniz
Wie das chaotische Leben eine einheitliche Form erst in der Erinnerung der Trägheit der Toten annimmt, so ist eine philosophische Theorie in ihren Konsequenzen, also in ihrer Totalität deutlich greifbar erst in der Kritik, die sie an anderen artikuliert und in der formulierten Kritik, die an ihr selbst geübt wird. Im Jahr 1650 stirbt der Philosoph René Descartes. Die Wirkung und Wirkungsgeschichte seiner strengen Form des Cogito begründet einen historischen Bruch, die Neuzeit. Die strenge Form besteht darin, dass sie den freien Zweifel des Skeptizismus zu einem rein methodologischen, an die Sprachäußerung gebundenen eingrenzt, den eine letzte Instanz begründet, das denkende Ich. Dieses Ich ist unablösbar an die Idee der Vollkommenheit Gottes geheftet, die allem Bezweifelbaren entgegensteht, folglich auch dem nur allzu oft nicht vollkommen erkennenden Ich. Der methodische Zweifel ist aber doch gerade auch das, was den Blick aufs freie Feld der Natur erst eröffnet. Es gibt nur eine mögliche Aussage, die nicht bezweifelbar ist: cogito ergo sum; sie erlaubt erst Unabhängigkeit vom Bibelglauben und damit distanzierte Betrachtung der Res Extensa – zugleich ist sie, als Res Cogitans, immer noch durch die Idee Gottes abgesichert, und nur diese, also der Glaube, entwindet den Cartesischen Rationalismus dem Solipsismus, der weder zur Kommunikation der vereinzelten Iche untereinander noch zum theoretisch konsistenten, d. h. bruchlosen Brückenschlag zur Res Extensa fähig wäre.
Descartes tut so, als würde er den scholastischen und theologischen Wissenschaftsskeptikern Recht geben, aber er hält dabei die sprachliche Form der skeptischen Äußerungen besonders im Auge. Auf diesem Weg entdeckt er das denkende Ich als körperlose Substanz und als Platzhalter der Gewissheit, als etwas, das nicht in Frage gestellt werden kann, ganz im Gegensatz zum körperlichen Ich und überhaupt zu allem Körperlichen, d. h. zur ausgedehnten Substanz. Das Ich bildet aber nicht nur den selbstgewissen Ausgangspunkt für analytisches Wissen, sondern auch für solches über das mechanisch-technische der Natur, weil durch es die diffuse Mischung zwischen den eindeutigen Bewegungen der Körper in der Natur und den Vorstellungen der Seelen überhaupt zu einem Ende gekommen ist.
Zu Descartes Entdeckungen, die weiterentwickelt werden konnten, gehört die Analytische Geometrie, d. h. die Darstellung geometrischer Sachverhalte in algebraisch-analytischer Form, also in Gleichungen mit bloß zwei Unbekannten – x und y – in denen auch die Grundoperationen der Algebra genutzt werden können. Die Funktionsgleichungen bringen alle ein Abhängigkeitsverhältnis zum Ausdruck, das demjenigen von Grund und Folge bzw. Ursache und Wirkung analog ist. Wenn es für ein Denken nichts Ausgedehntes gibt, das sich nicht mathematisch beschreiben ließe, so gibt es für dieses auch nichts, das nicht einen anzeigbaren Grund hätte.
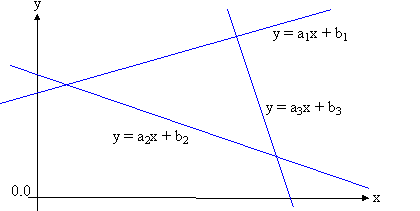
Die drei Geraden, sogenannte Cartesische Normalgeraden, schneiden sich so, dass die geometrische Form eines Dreiecks entsteht. Mit den Gleichungen lassen sich die Eckpunkte bestimmen; mit deren Hilfe dann, zusammen mit den geometrischen Grundsätzen, lässt sich die algebraische Form eines Dreiecks im allgemeinen formulieren, sein Umfang, seine Fläche.
Dieses Bild soll die Einsicht in drei Cartesische Zentralpunkte erleichtern. 1. Die Formel „clare et distincte“ weist auf Kants Formel von dem Verweisungszusammenhang, also der Unabtrennbarkeit von Anschauung und Begriff voraus. Einerseits ist die geometrische Figur das klar Angeschaute, das evident Einsichtige; andererseits ist in der Formel y = ax + b eine gezeichnete Gerade distinkt, d. h. analytisch formuliert. 2. Alles, was der Natur angehört, ist auf solche Weise darstellbar, nicht zu vergessen die Bewegungsabläufe und die Ortsveränderungen von Körpern; selbst komplexe statistische Ereignisse sind in solchen Bildern und Formeln diskutierbar. 3. Je strenger das „clare et distincte“ verstanden wird, um so näher ist der Cartesianismus beim kritischen Kant: was nicht in eine ähnliche Form gebracht werden kann, bleibt zwar denkbar, ist aber keine Erkenntnis mit ausgewiesener, verbindlicher Gewissheit.
Die methodologische Direktive der Gewissheit und der Selbstgewissheit – das eigentlich Neue gegenüber der Scholastik – ist die Gewähr für eine Allgemeinheit des Bewusstseins, welche die Betrachtung von Naturzusammenhängen zu einem Unternehmen macht, dem grundsätzlich jeder Mensch sich anschließen kann, frei seiner Meinung oder seiner geistigen Kräfte – dem aber umgekehrt dann auch jeder unterworfen ist. Die Neuzeit wirkt als Scharnier zwischen der mittelalterlichen Ontologie, der Epoche sowohl der Ordnung der Dinge wie der sozialen Ordnung durch Herkunft und der bürgerlichen Epoche der Fabrik der Polizei: der Ordnung des allgemeinen Gesetzes, dem durch Disziplinierung der Staatssubjekte auch Nachdruck verliehen werden kann.
Trotz dieser schematisch deutlichen Trennung der Epochen ist das Cogito, ist die Erfindung des Cogito zu wenig allgemein, klar und generell, als dass sie diese Epochen reibungslos verbinden würde. Denn alles, was vom Cogito erkannt wird, ist ausschließlich mechanisch existierend, folglich auch alle anderen denkenden Iche. Zwischen der Freiheit der denkenden Substanz und der Determiniertheit der ausgedehnten Substanz klafft ein Abgrund, der die Realität als ganze darin hinabstürzen lässt.
Das Erbe von Descartes, das anfänglich so klar und erhellend einhertritt, besteht im Grunde aus einem sich auftürmenden Haufen von Schutt und Trümmern, der ohne weiteres als Echo einer noch viel weiter zurückliegenden Epoche zu entziffern ist. (Die Idee des Trümmerhaften in der Theorie ist also viel älter als der Barock und das zwanzigste Jahrhundert.) In den Ruinen der Gewissheit wächst eine Denkmaschine heran, die der moralischen, sozialen und ökonomischen Errichtung eines menschenwürdigeren Gesellschaftslebens bestimmtere Fundamente zu bauen sich verpflichtet fühlt. Gottfried Wilhelm Leibniz studiert in Jena und Leipzig Philosophie und Rechtswissenschaft. Über sein Verhältnis zur letzteren schreibt er:
“Ich verschaffte mir früh eine genaue Kenntnis dieser Wissenschaft; denn an dem Beruf des Richters fand ich Vergnügen, während ich mich von den Ränken der Advokaten abgestoßen fühlte.“ [1]
Nach dem Verfertigen von insgesamt drei Dissertationen verzichtet Leibniz auf die Sackgasse der universitären Laufbahn; als „Geheimer Rat“ wird er bis an sein Lebensende im Dienste verschiedener Fürsten zu stehen haben. So bekömmlich, wie er es sich hier als Dreißigjähriger vorstellt, sind ihm diese Dienstverpflichtungen allerdings nicht geworden:
“… so ist aller mein wundsch gewesen eine hohe Person zu finden, so die leüt unterscheiden, von den dingen gründtlich urtheilen, und durch dero protection, ansehen, hülff und vorschub allerhand nüzlichen gedancken einen nachdruck geben köndte. Dagegen ich von andern sorgen befreyet einzig und allein zu dero gloire und vergnügung arbeiten würde.“ (Chronik 47)
Immerhin waren die Dienstverpflichtungen doch mehrheitlich von solcher Art, dass sich die theoretischen Tätigkeiten des Grundlagenforschers fruchtbar mit ihnen zu kreuzen vermochten. Was die gehaltvollen Schriften von Leibniz betrifft, so kann man sagen, dass sie in einer erstaunlichen mäzenatischen Unabhängigkeit und frei von Konzessionen entstanden sind. Zu seiner Lebzeit wurde allerdings nur ein einziges geschlossenes Buch veröffentlicht, das er zudem nicht unter seinem eigentlichen Namen herausgeben wollte, da er sich selbst nicht als einen Theologen betrachtete: Die Theodizee. [2] Die übrigen Schriften des sehr produktiven Autors Leibniz lassen sich aufteilen a) in sehr ausführliche und repetitive Briefwechsel (die jeweils zu veröffentlichen es üblich war), b) in Aufsätze, die in sogenannten Weisheitsjournalen erschienen waren (auf französisch oder lateinisch, später auch deutsch), c) in Beratungsschreiben an die Fürsten sowie d) in eine Unmenge zurückgehaltener, nachgelassener Schriften, worunter auch zu zählen sind die Monadologie und die Neue(n) Abhandlungen über den menschlichen Verstand, ein heute unzugängliches Riesenwerk über John Locke. Diese Schrift, Produkt des 60jährigen, ist in einem populär gehaltenen Dialog abgefasst, zwischen einem Philalethes und einem Theophilus. In der Person des letzteren spricht Leibniz über sich selbst:
“Ich bin auf ein neues System gestoßen, von dem ich etwas in den gelehrten Zeitschriften von Paris, Leibzig und Holland und in dem bewundernswürdigen Wörterbuch Bayles (art. Rorarius) gelesen habe. Seitdem glaube ich das Innere Wesen der Dinge in einem neuen Lichte zu sehen. Dieses System scheint Plato mit Demokritus, Aristoteles mit Descartes, die Scholastiker mit den Neueren, die Theologie und Moral mit der Vernunft zu versöhnen. Von allen Seiten scheint es das Beste zu nehmen und dann weiter fortzuschreiten, als man jemals gekommen ist. Ich habe in ihm eine verständliche Erklärung der Einheit von Seele und Leib gefunden, etwas, woran ich zuvor verzweifelt war. Die wahren Prinzipien der Dinge finde ich nunmehr in den substantiellen Einheiten, die dieses System einführt, und in ihrer durch die Ursubstanz vorherbestimmten Harmonie.“ [3]
In dieser zurückblickenden Selbsteinschätzung von Leibniz ist zu beachten, wie die unbedingte Verbundenheit mit der Tradition der Philosophie hervorgehoben wird. Derselbe philosophische Konservativismus, der nicht mit Schwäche in Verbindung gebracht werden darf, zeigt sich ebenso deutlich in einer kleinen Schrift gegen den soeben erwähnten Pierre Bayle aus dem Jahr 1698:
“Die Erwägung dieses Systems zeigt auch, dass man, wenn man den Dingen auf den Grund geht, in den meisten philosophischen Sekten mehr Vernunft entdeckt, als man zuvor geglaubt hat. Die geringste substantielle Realität der Sinnen-Dinge, die die Skeptiker, die Zurückführung aller Dinge auf Harmonien oder Zahlen, auf Ideen und Perzeptionen, die die Platoniker gelehrt haben; das identische, allumfassende Eine des Parmenides und Plotin, das dennoch allem Spinozismus fern bleibt, die stoische Notwendigkeit, die dennoch mit der Selbsttätigkeit verträglich ist, die Lebensphilosophie der Kabbalisten und Hermetiker, nach denen es überall Empfindungen gibt, die Formen und Entelechien des Aristoteles und der Scholastiker, die trotzdem die mechanische Erklärung aller besonderen Phänomene gemäß Demokrit und den Modernen nicht ausschließen: dies alles findet sich hier wie in einem perspektivischen Zentrum vereinigt, aus dem der Gegenstand – der von jeder andren Stelle betrachtet wirr erscheint – seine Regelmäßigkeit und die Übereinstimmung seiner Teile erkennen lässt. Der größte Fehler, den man begangen hat, besteht in dem einseitigen Sektengeist, vermöge dessen man sich selbst borniert hat, indem man alle andren Meinungen verwarf.“ [4]
Wo aber sind nun diese voneinander weg weisenden Probleme alle so schön gelöst? Auf welche Weise ist das System von Leibniz zu verstehen?
Wie erwähnt, verläuft im 17.~Jahrhundert die wissenschaftliche Diskussion, die die Grundlagen für den Wissenschaftsbetrieb – die Form der Gewissheit – erst zu liefern sich anschickt, nicht über die simplen Verteiler, Medien und gesellschaftlichen Relais, wie sie heute bekannt sind: weder bestanden reibungslose Verkehrswege, noch gab es akzeptable Kommunikationsmittel und Wissenschaftszusammenkünfte bzw. Wissenschaftskongresse. Im Jahr 1686 schreibt Leibniz – an einem Ort, wie er sagt, wo er während einiger Tage nichts zu tun hatte – einen langen Aufsatz mit der Überschrift Discours de metaphysique. Sein Zweck ist aber nicht kontemplativ; es gilt, „neue Einblicke zu eröffnen“ und dadurch „sehr große Schwierigkeiten zu beheben“ (Chronik 78).
Ich zitiere die ersten Zeilen:
“Der gebräuchlichste und charakteristischste Begriff, den wir von Gott haben, wird durch die Ausdrücke, dass Gott ein unbedingt vollkommenes Wesen sei, zwar ganz gut wiedergegeben, doch pflegt man sich die Folgerungen, die sich aus diesem Satze ergeben, nicht genügend klar zu machen. Will man hierin weiter eindringen, so muss man vor allem darauf achten, dass es in der Natur gänzlich verschiedene Arten von Vollkommenheiten gibt, dass Gott sie alle zugleich besitzt, und dass jede ihm im allerhöchsten Grade angehört. Man muss auch erkennen, was man unter Vollkommenheit zu verstehen hat, wofür es hier ein ziemlich sicheres Kriterium gibt. Diejenigen Formen oder Naturen nämlich, die ihrem Wesen nach keinen höchsten Grad zulassen, wie z. B. die Zahl oder die Figur, können nicht als Vollkommenheiten gelten. Denn die größte aller Zahlen – oder die Zahl aller Zahlen – ebenso wie die größte aller Figuren, schließt einen Widerspruch ein; das größte Wissen aber und die Allmacht enthalten nichts Unmögliches. Macht und Wissen sind daher Vollkommenheiten und haben, sofern sie Gott angehören, keine Schranken. Daraus folgt, dass Gott, der die höchste und unendlichste Weisheit besitzt, auch in der vollkommensten Weise handelt, und zwar nicht nur im metaphysischen, sondern auch im moralischen Sinne.“ (Cassirer II, 135)
Das ist der Kerngedanke, den Leibniz 25 Jahre später zum Monumentalwerk der Theodizee auswalzen wird. 1686 ist er aber erst noch die Schale eines unprätentiösen, theoretischen Problems, das diskutiert werden muss. Leibniz schickt die Abhandlung an Antoine Arnauld; dieser war ein berühmter Cartesianer und Theologe von Port-Royal, der Klosterschule bei Paris. Prompt hat er sich verkalkuliert! Die Abhandlung beginnt zwar in einem braven, theologischen Ton; in ihrer Fortsetzung findet sich aber ein Stoff, der weder mit der Offenbarungstheologie noch mit der Cartesischen Mechanik zu vereinbaren ist, mit deren Schwierigkeiten man sich abzufinden beliebte. Es entsteht folglich ein mühsamer Briefwechsel, der aber Leibniz schlussendlich doch noch einen Gewinn verschafft: Leibniz hat einen Referenten gefunden, auf den er sich fortan beziehen darf. Und so hat denn das 1695 im Pariser Journal des Sçavans veröffentlichte Neue System der Natur und der Gemeinschaft der Substanzen, wie der Vereinigung zwischen Körper und Seele einen leichten Anfang:
“Dieses System habe ich vor mehreren Jahren aufgestellt und es verschiedenen Gelehrten mitgeteilt, vor allem einem der größten Theologen und Philosophen unserer Zeit (Herrn Arnauld), der durch eine hochstehende Person von meinen Ansichten gehört und sie sehr paradox gefunden hatte. Als er aber meine näheren Aufklärungen erhalten hatte, nahm er in der edelsten und erfreulichsten Weise sein Urteil zurück und trat teils meinen Sätzen bei, teils zog er in Betreff der anderen, in denen er noch nicht mit mir übereinstimmte, seinen Tadel zurück.“ (Cassirer II, 258)
Man muss sich vergegenwärtigen, dass das Cartesische Cogito zwar die Natur zu maschinisieren, d. h. in ihren objektiven und systematischen Verweisen zu erklären verhilft, dass es aber keineswegs die erforderliche Allgemeinheit erreicht, die den Zusammenhang der zwei Substanzen Res Extensa und Res Cogitans in sich selbst, also im denkenden Bewusstsein, im Cogito fundieren könnte. Diesem konstitutiven Bruch beugte sich die Gesellschaft, um so mehr es gerade dieser Abgrund ist, der die Theologie bestärkt, weil er die Philosophie eben als ein brüchiges, in sich unstimmiges Gebilde darstellt. Leibniz, der seine Rationalitätsmaschinerie ungleich seiner ganzen Umgebung zu beschleunigen imstande war – ihm war dieser Bruch schlicht unnötig. Folgerichtig kommt es im Fortgang des Neuen Systems zu den nachstehenden Sätzen, die den katastrophischen Kern, d. h. das Atomare der philosophischen, systembildenden Vernunft im allgemeinen hüten:
“Ich habe bei dem Versuch, die Prinzipien der Mechanik selbst tiefer zu begründen, um von den Naturgesetzen Rechenschaft zu geben, die die Erfahrung uns lehrt, erkannt, dass die alleinige Betrachtung einer ausgedehnten Masse nicht ausreicht, und dass man den Begriff der Kraft hinzunehmen muss, der für den Verstand völlig erfassbar ist, wenngleich er ins Gebiet der Metaphysik gehört.“ (Cassirer II, 259)
Das ist der zentralste Satz im Leibnizischen System und ein nicht weniger bedeutsamer fürs Verständnis der Systematik der Geschichte im ganzen. Was sind seine Elemente?
Gewiss gilt es heute als unfein, die physikalische Welt mit der Leibnizischen Offenheit metaphysisch begründen zu wollen. Was bei Leibniz so entblößt dasteht, ist aber ein Schematismus, der das abendländische Denken auch dann noch durchzieht, wenn es sich die unschuldige Haltung gegenüber der Metaphysik abgestreift hat. Denn was immer gezählt haben wird in der sei es philosophischen oder soziologischen Theorie, ist das eigentümliche Verlangen, mehr Kompetenz auch da noch zu haben, wo das lebendige Bewusstsein längst mit Abklärung, mit einem Schulterzucken sich nach einem Ort der Distanz umgesehen hat.
Leibniz aber spielt mit offenen Karten. Vielleicht lastet auf dem Begriff der Metaphysik nicht dieser verschleierte Zauber der Willkür, von dem man glauben muss, dass er mit den Dingen treibt, was er nach Belieben will.
Es besteht für den Menschen die von Descartes explizierte Grunderfahrung, dass er in der Natur auf ein Gesetz stößt, dem auch er trotz aller seiner wesentlich, substantiell ihm zukommenden Freiheit unterworfen ist – das der Kausalität – und dass er in sich trotz aller Trägheit ein freies Begehren findet, das für sich alleine keine Kausalität auslösen kann, das aber auf dem Umweg des handelnden menschlichen Körpers auf Kausalvorgänge einwirken kann. Es ist dies eine Leistung von Leibniz, dass er die Verknüpfung von Begehren und Körper in einen Zusammenhang bringt, der ohne seine spezifische Letztbegründung auch für moderne Augen gar nicht so unplausibel dasteht.
Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass sich das vom Menschen Verschiedene – die lebendige, organische Natur – nicht mit dem Begriffssystem der Mechanik alleine verstehen lässt. Die Pflanzen- und Tierwelt hat eine gewisse eigene Kraft, die sie in gewisser Hinsicht vom reinen Gesetz der Kausalität befreit. Was es als Wirklichkeit im ganzen gibt, ist einzig der gütige Gott und das Universum (oder die Welt). [5] Es ist die unendliche Teilbarkeit des Universums oder die unfassbare Vielfalt des Vorhandenen, der Materie, das die Philosophen beunruhigt, und es gehört wesentlich zu ihrem Unternehmen, auf möglichst einfältige Art die Arten der Vielfältigkeiten zu reduzieren. Die unendliche Teilbarkeit des Universums muss also reduziert werden auf letzte Einheiten, die für den philosophierenden Menschen als einsichtig nachvollziehbare, als wahrnehmbare gelten können. (Es sei zur Erleichterung der kritischen und distanzierenden Betrachtung vorweggenommen, dass diese letzten Einheiten nicht dem Universum selbst angehören, sondern nur nach ihm drängen.) Leibniz nennt sie wahrhafte Einheiten, reelle Einheiten, reelle und sozusagen beseelte Punkte, substantielle Formen, erste Entelechien, ursprüngliche Kräfte und ab 1695 Monaden.
Jede Monade ist unteilbar und von außen unbeeinflussbar; deswegen transzendiert sie das Reich der Kausalität. Es gibt nicht zwei Monaden, die identisch wären, und doch spiegelt jede Monade das ganze Universum wider – in je verschiedener Weise und in verschiedener Klarheit und Distinktheit. Das Wesen der Monade ist das Streben nach Selbstpräsenz. In der Spiegelung präsentiert die Monade das Universum wie sich selbst. In der Präsentation steckt das Verlangen nach dem Ganzen – nach dem ganzen Universum: die Monaden schließen sich zu Monadenverbänden zusammen. Je komplexer der organische Monadenverband ist, um so distinkter repräsentiert er das Universum. Die Monadenverbände der Tiere und der Menschen sind die komplexesten, weil sie beide den mechanistisch-analytischen Bereich übersteigen. Die Monadenverbände der Menschen werden Seelen genannt; als ein Ganzes bilden sie eine Individualität [6] , die nach dem Tode des Körpers in ein höheres Leben steigt. Die Tiermonadenverbände sind demgegenüber nicht individuell. Die Gesamtmenge einer Tierart bleibt sich immer gleich. Und ein verendendes Tier stirbt nicht wirklich:
“Da es demnach weder eine erste Geburt, noch eine gänzlich neue Zeugung des Tieres gibt, so folgt daraus, dass es auch keine endgültige Auslöschung und keinen völligen Tod im strengen metaphysischen Sinne gibt. An Stelle der Wanderung der Seelen tritt somit nur die Umgestaltung eines und desselben Tieres.“ (Cassirer II, 263)
Es drängt sich an diesem Punkt für Leibniz die Frage auf, was er denn gewonnen hat – denn ist nicht einfach die Res Cogitans in einen anderen Aggregatszustand transformiert worden, in dem sie sich in vielen Einzelpunkten darstellt, die aber wie die solipsistischen Iche in die Welt der Körper nicht direkt eingreifen können, weil sie sie nur vorstellen? Tatsächlich schreibt er: „Descartes hatte an diesem Punkte, soviel man wenigstens aus seinen Schriften erkennen kann, das Spiel aufgegeben.“ (Cassirer II, 266) Nach wie vor gilt die Suche dem Steg, der die Welt der Körper, die dem Kausalitätsgesetz unterworfen ist, mit den Monaden verbindet, die doch – als fensterlose – keine Beeinflussung von außen in sich ergehen lassen.
1695 entledigt sich Leibniz dieses Problemes auf beinahe lapidare Art: Dass es in der Welt der Monaden weder – durch telekinetische Störungen – zu einem Chaos kommt, noch die Menschenseelen wie bei Descartes in einem elenden Solipsismus auf sich selbst geworfen sind, spricht für die Unerschütterbarkeit der Hypothese, dass die Monaden, die nicht dem Gesetz der Kausalität unterworfen sind, eine um so gemeinsamere Ursache haben:
“Es liegt darin auch ein neuer Beweis für die Existenz Gottes, der von überraschender Klarheit ist; denn die vollkommene Übereinstimmung so vieler Substanzen, die nicht in Verbindung untereinander stehen (weil sie fensterlos und deswegen jenseits des Bereichs der Kausalität existieren; U. R.), kann nur aus der gemeinsamen Ursache stammen.“ (Cassirer II, 269)
Pierre Bayle wird – und hat es zu dieser Zeit schon getan – über die Vorstellung der Allmacht dieser Urmonade witzeln, die die Bewegungen aller Monaden zu regulieren und zugleich auf deren relative Unabhängigkeit vom Gesetz der Kausalität zu achten hat. [7] Erinnert man sich aber daran, dass Leibniz nichts mit dem materialistischen Atomismus zu tun hat, weil die Monaden keine toten Punkte sind, sondern triebhafte Vorstellungsautomaten [8] , die jeder für sich das ganze Universum enthalten, auf verschiedene Art und mit verschiedener Klarheit – so dürfte einsichtig werden, dass dieser Leibnizische Determinismus eine recht eigentümliche Freiheit garantiert. Denn was dieser Gott reguliert, sind nicht einfach so die Ereignisse im Leben, sondern die strukturierenden Gesetze, auf denen sich die Ereignisse bewegen. Dies ist zum einen der Gesetzesbereich der Kausalität, zum anderen der der Zweckhaftigkeit (Ch. Wolff nennt dies später die Teleologie), wobei dieser Begriff in seiner ganzen komplexen und dunkeln Mehrdeutigkeit zu verstehen ist: moralisch, handlungstheoretisch, physikalisch, ästhetisch und metaphysisch. 1714 schreibt Leibniz zwei Fassungen des Systems. Die eine wird 1720 als Monadologie veröffentlicht, die andere schreibt er für den Prinzen Eugen, mit dem Titel Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade. Daraus ein Zitat:
“Da nun infolge der Erfüllung der Welt alles miteinander in Verknüpfung steht [9] , und jeder Körper, je nach der Entfernung, mehr oder weniger auf jeden anderen einwirkt, so folgt daraus, dass jede Monade ein lebender, der inneren Tätigkeit fähiger Spiegel ist, der das Universum aus seinem Gesichtspunkte darstellt und der ebenso geregelt ist, wie dieses selbst. Die Perzeptionen in der Monade entstehen aus einander nach den Gesetzen des Strebens oder nach den Zweckursachen des Guten und Bösen, die in geregelten oder ungeregelten bemerkbaren Perzeptionen bestehen, wie die Veränderungen der Körper und die äußeren Erscheinungen gemäß den Gesetzen der wirkenden Ursachen, d. h. der Bewegungen aus einander hervorgehen. Auf diese Weise besteht eine vollkommene Harmonie zwischen den Perzeptionen der Monade und den Bewegungen der Körper, die vom Anfange der Welt an zwischen dem System der Zweckursachen und dem der wirkenden Ursachen prästabiliert ist. Hierin eben besteht die Übereinstimmung und die natürliche Vereinigung von Seele und Körper, ohne dass eins die Gesetze des andren ändern könnte.“ (Cassirer II, 424f)
Ich versuche nun, das Terrain ein wenig zu verschieben. Was ich bis jetzt vorzustellen versucht habe, könnte man unter den Hut des eindeutig vitalistischen Leibniz stellen. Die profane Zerrissenheit in der Cartesischen Selbstgewissheit heilt Leibniz durch die Kräfte des Lebens, wodurch er dieses, das Leben, ins Recht setzt, wie vor ihm in der Geschichte der Philosophie kaum je ein Theoretiker es zu tun wagte und nach ihm keiner so ausgeprägt wie Nietzsche – mit Ausnahme von Pierre Bayle, der dies paradoxerweise als unnachgiebigster Kritiker von Leibniz tut.
Wie sonst nirgends in einer Philosophie ist im Leibnizischen Denken das uralte Theologumenon von der Gleichzeitigkeit des Voluntarismus bzw. Vitalismus und des Intellektualismus – Gott ist sowohl allmächtig wie allwissend – in folgeträchtigem Maße vorausgesetzt. Der vitalistische Leibniz, der Entdecker der Monaden, muss also durch den intellektualistischen bzw. panlogistischen ergänzt werden. Denn Leibniz ist kein Privatmensch mit einer Privatphilosophie; er ist Mann des Hofes. Das Leben der Menschen der Straßen und der Kneipen interessiert ihn nur vom Standpunkt des urteilenden Richters her und nicht von dem der Advokaten, die sich mit den Wirren, in die die Gesetze eingelassen sind, auseinanderzusetzen haben. Der Richter aber bedarf des souveränen Überblicks. Und dieser ergibt sich von einem optimalen Gesichtspunkt aus, der in seiner allgemeinsten Form als „die Wahrheit“ einhertritt, so wie sie die Möglichkeit des Verstandes einerseits und die Möglichkeit der sinnlichen Wahrnehmung andererseits, einander ergänzend, nahelegen. Welches ist die Form dieser Möglichkeiten der Wahrheit? So wie die analytischen Wahrheiten des Verstandes auf letzte Identitäten zurückführbar sein müssen, so müssen die Sätze übers Empirische begründbar sein. Die unerschütterlichen Prinzipen desjenigen, der sich der Wahrheit selbstgewiss genähert hat, sind der Satz des verbotenen Widerspruchs und der Satz des zureichenden Grundes. [10] Die Auseinandersetzung mit Bayle zeigt, plastisch insbesondere in der Theodizee, welche Starrheit sich aus dem Umgang mit diesen Sätzen ergibt, eine Starrheit, die sich nicht mit der Geduld des Ewigen zufriedengibt, sondern Kräfte entfaltet, die die Ereignisse selbst, die dem Wechsel der Zeit angehören, strukturieren, von denen sie, die allgemeinen Sätze, doch sagen, dass sie sie nur betrachten, um von ihnen der Möglichkeit nach Kunde zu geben. Die Fixierung auf die Analyse des logisch Notwendigen ist immer nur zum Schein kontemplativ und immer nur zum Schein rein technisch-instrumentell, denn im selben Zug erklärt sie auch das empirisch Notwendige. Der Größenwahnsinn, ja der Wahnsinn überhaupt des Erklärens bildet immer auch die Grundlage für die allgemeinste, d. h. nicht antastbare, nicht auf das sprechende Subjekt beziehbare, scheinbar nicht ideologische Rechtfertigung der Existenz des Seienden. Dazu eine erhellende Passage aus den Vernunftprinzipien:
“Bis hierher haben wir nur als einfache Physiker geredet: nun ist es Zeit, sich zur Metaphysik zu erheben, indem wir uns des gewaltigen, wenngleich gemeinhin wenig angewandten Prinzips bedienen, wonach nichts ohne zureichenden Grund geschieht, d. h. nichts sich ereignet, ohne dass es dem, der die Dinge hinlänglich kennte, möglich wäre, einen Grund anzugeben, der genügte, um zu bestimmen, warum es so ist und nicht anders. Ist dieses Prinzip einmal angenommen, so wird die erste Frage, die man mit Recht stellen darf, die sein: Warum es eher Etwas als Nichts gibt. Denn das Nichts ist doch einfacher und leichter als das Etwas. Nimmt man weiterhin an, dass Dinge existieren mussten, so muss man Rechenschaft davon ablegen können, warum sie so und nicht anders existieren müssen.“ (Cassirer II, 428)
Der letzte Halbsatz, der hier hervorgehoben wird, ist derjenige Grundsatz, der die ganze Leibnizische Theodizee reguliert. Man muss sich vorzustellen versuchen, was er bedeutet, wenn er psychologisch aufs eigene Leben, und was, wenn er, etwa in der Form der wissenschaftlichen Soziologie, also verwaltungstechnisch, auf gesellschaftliche, nicht-individuelle Charakteren bezogen wird. An dieser Stelle benutzt ihn Leibniz nicht zur Verklärung, sondern als Bestandteil seines Modells der Erklärung. Denn im Anschluss heißt es:
“Nun lässt sich dieser zureichende Grund für die Existenz des Universums nicht in der Reihe der zufälligen Dinge, d. h. der Körper und ihrer Vorstellungen in den Seelen finden. Denn die Materie ist an sich gegen die Ruhe oder die Bewegung und gegen eine so oder so beschaffene Bewegung indifferent; man kann also in ihr nicht den Grund für die Bewegung überhaupt, und noch weniger (!) für eine bestimmte Bewegung finden.“
Das ist bloße Rhetorik, und zwar eine solche, die das Augenmerk von bestimmten Punkten ablenken soll. Denn was heißt „man kann nicht“ und „man kann noch weniger“? Ein bisschen also hat die Bewegung mit der Materie zu tun – aber das Bisschen erscheint dem tiefsinnigen Grundlagenforscher als eher störendes, jedenfalls vernachlässigbares Detail? Immerhin begrüßte Leibniz das Werk des Zeitgenossen John Toland, den er auch persönlich kannte (beide waren sie Staatsunterhändler), und er gibt ihm gegen Spinoza Recht. [11] In seinen Briefe(n) an Serena legte Toland – materialistisch – dar, dass die Bewegung notwendig zur Definition der Materie gehöre. [12] Aber der Fortgang der Geschichte beruht ganz offenbar auf Täuschungsmanoeuvern, und Leibniz bewegt sich unbeirrt auf sein Ziel zu, das er sich selbst gesteckt hat, nämlich darzutun, dass das, was sich als Bewegung ereignet, von großer Hand gesteuert wird [13] , seinen Grund also nicht in der Struktur der Bewegung selbst hat.
“Der zureichende Grund, der keines andren Grundes bedarf, muss also außerhalb dieser Reihe der zufälligen Dinge liegen und sich in einer Substanz vorfinden, die die Ursache der Reihe und ein notwendiges Wesen ist, das den Grund seiner Existenz in sich selbst trägt; denn sonst hätte man noch immer keinen zureichenden Grund, bei dem man stehen bleiben könnte. Diesen letzten Grund der Dinge aber nennen wir Gott. … Aus der höchsten Vollkommenheit Gottes folgt, dass er bei der Hervorbringung des Universums den bestmöglichen Plan gewählt hat, gemäß dem sich die größte Mannigfaltigkeit mit der größten Ordnung vereinigt: bei dem der Platz, der Ort und die Zeit in der besten Weise verwendet sind, und die größte Wirkung auf die einfachste Weise hervorgebracht wird: kurz, bei dem den Geschöpfen die größte Macht, die größte Erkenntnis, das größte Glück und die größte Güte gegeben ist, die das Universum in sich aufnehmen konnte.“ (Cassirer II, 429f; Hervorhebung U. R.)
Mit diesem letzten Satz, aber auch mit der ganzen Theodizee, die ja darin besteht, den Plan der Welt einer Transzendenz zuzuweisen [14] , macht der intellektualistische Leibniz gegenüber dem vitalistischen einen zünftigen Rückwärtssalto: Die Entdeckung der Gesetze, die die Menschen als solche gleichwertig erscheinen ließen, wird zu Gunsten der Legitimation durch die Geburt aufgeweicht, in der das größtmögliche Glück immer schon seine Anlage gehabt hat. Der Plan ist so, dass von ihm gesagt werden muss, dass er den Geschöpfen, die selbst nicht Bestandteil des Universums sind, das Beste zukommen lässt, das das Universum in sich aufnehmen konnte. Das hat nicht zuletzt auch politische Konsequenzen:
“Il faut reconnoistre cependant que la question combien il est permis aux inferieurs de faire contre les superieurs est extremement delicate et difficile.“ [15]
Der Eindeutigkeit der Form der philosophischen Vernunft, die vom Möglichen der empirischen Ereignisse nur spricht, um sie desto unabänderlicher einer allgemeinen Notwendigkeit unterzuordnen, entspricht die Geschlossenheit der Geschichte, die sich seit je schon in dem Verlangen der Präsentation ihrer Präsenz gezeigt hat. Die Form der Vernunft ist ein Schema, das sämtliche Abläufe strukturiert und das darin besteht, eine Identität zu unterstellen, von der die Ereignisse, das historisch im Leiden Sedimentierte oder das philosophisch begrifflich Formulierte, ausgeschickt sind. Der Verweis auf diese letzte Instanz, die man sowohl Geschichtlichkeit nennen wie auch als logische Evidenz fassen könnte – dieser referentielle Verweis verschafft dem verständigen Philosophen eine Position, die das absolute und unerschütterliche Privileg fürs Argumentieren hütet. Eine solche Position kann nichts erschüttern, da sie sich immer der Struktur, die die Ereignisse formiert, entzieht. Die Berufung auf die Philosophie, als typische Geste sowohl des Berufsphilosophen wie des Ideologen und Dogmatikers, entzieht sich immer den real-historischen Diskursformationen, die das Feld der sozialen Kämpfe sowohl abbilden wie konstituieren – sie entzieht sich also den Bedingungen der Möglichkeit der Problematisierung der Negativität einer bestimmten Gesellschaft. [16]
Wie aber verläuft eine Kritik an diesem Schema, wenn dieses selbst doch die privilegierte Stelle der Argumentation einnimmt, wenn also von ihm gesagt werden muss, dass es das Kritische und Subversive in sich einschließt nicht weit entfernt davon wie das Cartesische Cogito das Wahnsinnige, das Unvernünftige einschließt und es so zum Schweigen bringt, unduldsam, unter disziplinarischer Wache? [17]
Unter den Streitpartnern von Leibniz, die nicht trivial als gläubige Theologen den übersteigerten Rationalismus kritisierten, weil dieser den devoten Glauben an die Offenbarungskirche subvertieren könnte, sticht herausragend Pierre Bayle hervor. An Malebranche schreibt Leibniz, Bayle hätte ihn oft irritiert, und er fände dessen Gedanken „dangereuse et seduisantes“ [18] . In der Monadologie schreibt er bekanntlich:
“Herr Bayle sah sich sogar in seinem Wörterbuch zu der Annahme versucht, dass ich Gott zuviel und mehr als möglich Größe zuschreibe. Er vermochte indes keinen Grund anzugeben, weshalb diese allumfassende Harmonie unmöglich wäre.“ (Cassirer II, 448)
Leibniz' Größe liegt in der Entdeckung des Zusammenspiels, der Harmonie der zwei vormals getrennten Gesetzesbereiche der Zweck- und der Wirkursachen, die verständlich macht, wie die Freiheit des Willens auf die Ereignisse im Bereich der determinierten Körper Einfluss nehmen kann. Sein philosophischer Wahn bestimmt das Mögliche als das noch nicht perfekt Verwirklichte. Dieser Logizismus verleitet nur zu leicht zur Behauptung nach der möglichen Einsichtbarkeit in den Grund, der alle wirklichen Ereignisse verantwortet. Wie begegnet man einem Größenwahnsinnigen, dessen Uneinsichtigkeit dadurch zu charakterisieren ist, dass er sich als allgemeine Einsichtbarkeit dargestellt sehen will?
Genau diese Pattsituation ist die unmögliche, aber immerhin darstellbare Methode der Kritik am Systematischen der Geschichte; sie ist dasselbe wie die katastrophale Form der philosophischen Vernunft. Sowohl die Vernunft wie die Geschichte; sowohl die Geschichte der Vernunft wie selbst auch die Kritik an ihr scheitern im argumentativen Vorgehen. [19] Wie also ist das theoretisch unmögliche, in seiner Praxis aber darstellbare Unternehmen von Bayle zu skizzieren?
Pierre Bayle war Professor in Amsterdam, und da Herausgeber der Nouvelles de la République des Lettres und der Réponse aux questions d'un provincial. Die erste war eine philosophisch-wissenschaftliche Zeitschrift, die zweite eine populär-theologische. Sein Hauptwerk verfasste er aber erst nach seinem Abgang von der Universität, den er als Folge von Intrigen eines Freundes vorzeitig zu vollziehen hatte. Nunmehr frei von universitären Verpflichtungen, arbeitete er an einem epochalen Werk, das Grundlage für die berühmten Enzyklopädien der Aufklärung im folgenden Jahrhundert sein wird. Die Herausgeber der Bayle-Monographie von Ludwig Feuerbach beschreiben die Entstehung:
“Schon während der Herausgabe seiner eigenen Monatsschrift hatte er häufig auf die Ungenauigkeit mancher Angaben in historischen Werken hingewiesen und die nöthige Berichtigung gebracht. Im Laufe der Jahre hatte sich derartiger Stoff hinlänglich bei ihm angehäuft, und so war er gesonnen, ein solchem Zweck eigens dienendes Werk herzustellen. In Form eines Wörterbuches sollte es Unrichtigkeiten und Irrthümer in bräuchlichen Geschichtswerken, wie sie für den allgemeinen Leserkreis berechnet waren, berichtigen und die ihnen anhaftenden Lücken ergänzen, woneben auch andere beachtenswerthe Gegenstände zur Sprache zu bringen wären. Sein Buch hätte als Prüfstein der Verlässlichkeit umlaufender Angaben zu dienen. Wieviel Unrichtiges und Widersprüchiges über gewisse allgemein bekannte Vorgänge und Grössen gesagt und behauptet werde, sei jedem einsichtigen Leser hinlänglich bekannt. Die Aufgabe des neuen Werkes wäre also eine kritische: indem es lediglich die Richtigstellung von Irrthümern der fraglichen Art zur Aufgabe hätte, würde das dort unbeanstandet Belassene seine volle Verlässlichkeit erhalten.
Mit diesen Erklärungen hatte er sein Mitte 1692 veröffentlichtes Projet et fragment d'un Dictionnaire critique eingeleitet. Der Erfolg wollte seinen Erwartungen nicht entsprechen, obwohl das Berechtigte und Nützliche seines Vorhabens anerkannt wurde. Da leuchtete ihm ein, er würde seinen Zweck weit sicherer durch ein Werk erreichen, das unabhängig von allen Vorgängern den Stoff mit der von ihm erstrebten kritischen Genauigkeit behandeln würde. Hiemit war das Richtige getroffen. Schon in der zweiten Hälfte 1693 konnte der Druck beginnen, aber erst nahezu zwei Jahre später gelangte der erste Band an die Oeffentlichkeit, dem dann, nach gleichem Intervall, der zweite folgen sollte. Dieses Werk ist sein weltberühmtes Dictionnaire historique et critique, das über ein Jahrhundert hindurch ein Quell der Belehrung aller bildungsbedürftiger Leser im ganzen Bereich der westeuropäischen Cultur verblieben.“ [20]
Das Wörterbuch von Bayle ist kein Nachschlagewerk, so wie wir sie heute kennen. Das, was diese auszeichnet – die Vereinheitlichung von Definierbarem – wird im Historischen und Kritischen Wörterbuch gerade unterlaufen. Was es wesentlich angreift, ist alles, was in irgendeiner Form nach letzter Einheit trachtet. Man stelle sich statt eines informativen Fremdwörterbuches eher ein unverbindliches Konversationslexikon vor – denn auch als ein solches hatte es Furore gemacht. Die späte Freundin von Leibniz, die preußische Königin Sophie Charlotte, deren Mutter, die Kurfürstin Sophie, ebenso zum fragwürdigen Umgang Leibnizens gezählt werden muss [21] , hat ihr Wissen diesem Wörterbuch zu verdanken. In ihm aber steckt eine bewusste Strategie, nämlich die, dass es den Leser mehr ins Sich Hintersinnen verführen will als dass es ihn mit Informationen befriedigte. Die daraus erfolgte Verwirrung der Sophie Charlotte war es, die Leibniz dazu anspornte, mit ihr zusammen die Ordnung von Gott und der Welt wiederherzustellen. Denn ihr ist das jeden Zweifel beseitigende Werk der Theodizee nach ihrem frühzeitigen Ableben nachgeschickt worden. Es sieht ganz so aus, als ob eines der reaktionärsten Werke der Geschichte der Philosophie – und über lange Zeit war es eines der populärsten – Pierre Bayle zu verdanken ist, gewiss ohne seine Schuld. [22] Mit bedacht ist das Wörterbuch „verworren“; denn was es beinhaltet, sind möglichst viele Dogmen, die manchmal fast gleichzeitig, also ohne dass ihre Unterschiedlichkeit kenntlich würde, einen Artikel im Wörterbuch strukturieren, so dass sie sich von selbst ad absurdum führen. Bayle vollzog diese Strategie hemmungslos, was Feuerbach ganz am Schluss seiner Monographie zu dem kritischen, despektierlichen Satz verleitete: „Bayle hat wenig oder gar nichts zu verlieren: wer aber mit leeren Taschen seine Straße dahin zieht, der fürchtet keine Räuber.“ [23]
Was Bayle in diesem Monumentalwerk sichtbar vorführen will, ist, dass es kein begründbares Dogma für Glauben jeglicher Art geben kann. Die Reformierten [24] , die die Idee Gottes zum Gefühl und zur Subjektivität verinnerlichen, können nicht wie Leibniz Gott als Argument einsetzen. Für sie gibt es nur das Gewissen und die Toleranz. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass der Spruch des Aristoteles, wonach es nur eine Wahrheit gäbe und viele Abweichungen, auf die Füße gestellt wird: wo einstmals der Begriff der Wahrheit stand, rückt derjenige der Toleranz nach. Wenn die Toleranz grundlegender als die Wahrheit ist, hat alles, was Wahrheit im philosophischen Sinn beansprucht, den abstoßenden Geruch der Intoleranz. Feuerbach schreibt:
“Nicht ein Gedanke, ein Prinzip, ein spezifisches Mittel, sondern eine ganze Apotheke von Argumenten gegen das tief eingewurzelte Übel der Intoleranz wird hier vorgebracht. Bayle liefert eine mikroskopische Sektion dieses apokalyptischen Untiers – eine Infinitesimalrechnung der Polemik.“
Nichts könnte falscher sein, als Leibniz in seinem empirischen Leben und in seinen moralischen Schriften der Intoleranz zu bezichtigen. Offenbar muss der Begriff der Toleranz bei Bayle in einem bestimmteren Licht betrachtet werden, als dass er den kritisierten Widerpart der Intoleranz beschuldigen wollte.
In den Schriften Bayles funktioniert die Toleranz wie ein metaphysisches Prinzip. Nur als solches vermag es den souveränen Metaphysiker Leibniz „zu irritieren“. In allgemeiner Hinsicht wirkt die Toleranz als Politik; denn sobald ihr Prinzip einen gewissen Vorstellungsrahmen erreicht, setzt es ein Verlangen frei, das das Ursprungsverlangen nach Einheit, Grund und Identität konkurriert und damit zu ersetzen drängt. Diesem Identitäts- Ersatz liegt das Leben zu Grunde, welches Leibniz belächelt [25] . Der Satz vom Grund, logisches Prinzip, führt logizistisch zum Optimismus, wie immer das persönliche Leben oder die realen gesellschaftlichen Verhältnisse dreinschauen mögen. Steht aber als Letztes nicht ein Absolutes, sondern die gesellschaftliche Erfahrung, so wird das Gegebene nicht weiter systematisch verschleierbar.
Ist in der Philosophie der Primat der Identität vorherrschend, so kann Gott als Argument für alles herangezogen werden. Umgekehrt kann definitiv alles für eine Begründung in Anspruch genommen werden, wenn das Prinzip der Toleranz der letzte, metaphysische Grund sein soll. Das aber kommt einer Sabotage der Logik gleich, einer neu auferstandenen Willkür, die doch die Willkür des Logizismus außer Kraft setzen wollte. Die Toleranz vermag das Werdende und Sich Bewegende auszuhalten und ins Recht zu setzen. [26] Was aber dem Begriff der Toleranz trotz seiner möglichen Absolutheit abgeht, ist die substantielle Allgemeinheit. Diese muss die Toleranz mühsam am Rand der Theorie, weit eher schon praktisch, erkämpfen – und derselben Allgemeinheit ist sie erbarmungslos ausgeliefert. Selbst der deutsche, sehr geduldige Übersetzer des Wörterbuchs, Gottsched, schlägt sich auf die Seite des allgemein Erwartbaren, dahin, wo trotz aller Widersprüchlichkeit man gerne etwas Sicheres in den Händen trägt: „Herr Bayle ist zwar sehr witzig und spitzfindig, in Erfindung listiger Einwürfe: aber recht scharfsinnig ist er doch nicht.“ (Artikel Pyrrho.)
Mit dem Wurf der Theodizee, die im 18. Jahrhundert die gleiche Wirkungsgeschichte nach sich zog wie das Wörterbuch, dem sie so krass entgegensteht, ist es Leibniz gelungen, sich auch den Skeptizismus von Bayle einzuverleiben und damit den Absolutheitsanspruch der Vernunft zu verstärken und zu stärken. Bayle steht als ein Beispiel dafür, wie hoffnungslos es war, sein Leben dahin zu geben, die Schwierigkeiten des Gesellschaftslebens auch im Text wahrnehmbar zu machen. Das ist erst dann zu wagen, wenn die Differenz zwischen den Zeichen und dem Sinn in der Weise bereits erschüttert ist, dass die Zeichen selbst auf das Gesellschaftsleben Einfluss nehmen.
Ueli Raz
Bern, 12. Januar 1993
[1] Leben und Werk von G. W. Leibniz. Eine Chronik, bearbeitet von Kurt Müller und Gisela Krönert, Frankfurt am Main 1969, p. 7. (Im folgenden zit. als Chronik.) – Diese Aussage hat etwas Doppeldeutiges: Einerseits weist sie schon voraus auf die metaphysische Urteilswut der Rationalisten, andererseits veranschaulicht sie die Distanz zur unverbindlichen Spiegelfechterei der Scholastiker.
[2] Versuche in der Theodizee über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels, dt. Hamburg 1968, 11710, französisch.
[3] G. W. Leibniz, Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, Hamburg 1971, übersetzt, eingeleitet und erläutert von Ernst Cassirer, p. 33f.
[4] G. W. Leibniz, Aufklärung der Schwierigkeiten, die H. Bayle in dem neuen „System der Vereinigung von Seele und Körper“ gefunden hat (Juli 1698), in: G. W. Leibniz, Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, Band II, hrsg. von Ernst Cassirer, Hamburg 31966, p. 285f. (Im folgenden zit. als Cassirer II.)
[5] Die distinkte Unterscheidung zwischen der Welt und dem Universum wird erst im 18.~Jahrhundert durchgehalten – und zwar so, dass Kant von der Erdenwelt als dem Abort des Universums spricht (Immanuel Kant, Das Ende aller Dinge, Werkausgabe, hrsg. von Wilhelm Weischedel, Band XI, Frankfurt am Main 21978, p. 180). Leibniz hält zwar intelligentes Leben auf andern Planeten innerhalb oder außerhalb des Sonnensystems für möglich, ja er hält es sogar für wahrscheinlich, dass solche Wesen intelligenter wären als die Menschen; weil er sich aber bei seinen rationalen Analysen auf den irdisch fixierten Verstand beschränkt, ist bei ihm mit der geschöpften Welt oder mit dem Begriff des Universums immer die Erde gedacht. Es ist noch anzumerken, dass selbst der Leibnizische Rationalismus sich zu bescheiden weiß, wenn auch nur aus Gründen der Konsistenz des Systems.
[6] Der Mensch hat im Gegensatz zum Tier neben der Weltvorstellung auch eine Selbstvorstellung.
[7] Zur Chronologie vgl. das Doppelblatt mit der Referatszusammenfassung vom 1. 1. 1993 oder, ohne Mathematikfehler, vom 2. 1. 1993.
[8] Alex Sutter, Göttliche Maschinen – Die Automaten für Lebendiges bei Descartes, Leibniz, La Mettrie und Kant, Frankfurt am Main 1988, p. 86.
[9] Vgl. dazu Arthur O. Lovejoy, Die große Kette der Wesen – Geschichte eines Gedankens, Frankfurt am Main 1985. Das Buch bietet überhaupt eine sehr gute Darstellung der Neuzeit.
[10] Der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch: Eine Aussage und ihre Negation können zusammen nicht wahr sein. Der Satz vom zureichenden Grund: Alles was ist und was behauptet wird, hat einen zureichenden Grund dafür, dass es so ist, auch wenn die Gründe nicht zu erkennen sind (Monadologie ¦ 31f). Dazu Martin Heidegger, Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz, 1928, Gesamtausgabe Band 26, Frankfurt am Main 1978, p. 154: „Es ist charakteristisch für die mathematische Denkweise, dass Leibniz für seinen Zweck Wahrheit als identitas definiert, ohne gerade hier nach der possibilitas (Möglichkeit; U. R.) dieser identitas zu fragen.“
[11] Vgl. G. W. Leibniz, Textes inédits publ. par G. Grua, Bd. I und II, Paris 1948.
[12] John Toland, Brief V: Bewegung als eine wesentliche Eigenschaft der Materie – Als Antwort auf einige Bemerkungen eines vornehmen Freundes zu meiner Widerlegung Spinozas, in: Briefe an Serena. Über den Aberglauben. Über Materie und Bewegung, Berlin 1959, p. 120.
[13] Der drohende Fatalismus entfällt bei Leibniz, weil die Vernunft ja die Steuerung zu durchschauen vermag, gerade nicht ihr Opfer ist.
[14] Entzieht man dem Plan ein planendes Subjekt, so hat man es mit einem Immanenzplan zu tun, der sowohl in einer idealistischen Fassung denkbar ist, wie bei Spinoza, als auch in einer materialistischen, vielleicht wie bei Toland. – Vgl. zu diesem Begriffspaar Gilles Deleuze und Claire Parnet, Dialoge, Frankfurt am Main 1980, p. 99ff.
[15] Ca. 1690; Grua, a. a. O., p. 885.
[16] Wenn hier pauschalisierend gesagt wird, die philosophische Vernunft würde immer nur imstande sein, einen dogmatischen Ausgangspunkt anzugeben, solange sie ihn positiv beschreibt – muss man dann einem Irrationalismus nachgeben? Nicht im geringsten, weil die philosophische Vernunft nicht mit dem Begriff des rationalen Verhaltens und der rationalen Argumentation gleichgesetzt werden muss. Aber der Ausgangspunkt kann kein einfacher sein, kann keiner sein, der nicht schon eine gewisse Komplexität aufweisen würde. Wenn er nicht gelehrt werden kann, heißt dies nicht, dass er sich nicht durch Anstrengung aneignen ließe. Er besteht dann in der Negativität des vorliegenden Ganzen. Es ist weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes, nach einem Ausgangspunkt ausschauzuhalten, der einem ein Recht auf Einsicht in die Vernünftigkeit der Vernunft gewähren würde. Gewiss ist nur, dass aus dem moralisch Guten ein Schlechtes wird, wenn in der Anstrengung nachgelassen wird; die Anstrengung ist nicht individuell und privat, sondern substantiell und allgemein – sie ist immer gesellschaftlich, auch wenn sie als das Negative im wesentlichen Gesellschaftliches erkennt.
[17] Vgl. Jacques Derrida, Cogito und Geschichte des Wahnsinns, in: Die Schrift und die Differenz, Frankfurt am Main 1976, vor allem p. 89. Michel Foucault sagt in seinem Buch Wahnsinn und Gesellschaft – Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, im Mittelalter sei der Wahnsinn akzeptiert gewesen; das zeigt sich in den scholastischen Systemen so, dass die Vernunft sich nicht abschließend rechtfertigen kann: die philosophisch-logische Begriffsanalyse steht im Dienste des Glaubens und der Kirche. Eine Rechtfertigung der Vernunft geschieht erst im Cogito bei Descartes. Von hier an wird der Wahnsinn zum Schweigen gebracht, und es beginnen die disziplinierenden Gesellschaftsmechanismen der Ausgrenzung und der institutionellen Einschließungen. Derrida widerspricht dieser Descartes-Deutung. Denn der methodische Zweifel ist an die sprachliche Entäußerungsform gebunden. Und die Aussage „Ich denke also bin ich“ ist keine, die nicht auch von einem Wahnsinnigen gemacht werden könnte. Folglich ist der Rationalismus, der im Cogito seinen Grund hat, nicht befähigt – er ist nicht fähig und er hat keine Kompetenz dazu – etwas über die Vernünftigkeit der Vernunft auszusagen; er vermag nichts über ihr Verhältnis zum Wahnsinn auszusagen und nichts über den Wahnsinn in der Geschichte als die Geschichte der Vernunft.
[18] G. W. Leibniz, Die philosophischen Schriften, hrsg. von C. I. Gerhardt, Berlin 1875 - 1890, Band I, p. 359.
[19] Man kann sich das einfach vorstellen: alles wäre anders, ohne ganz anders sein zu müssen. Selbstverständlich darf daraus nicht der Schluss gezogen werden, die argumentierende Vernünftigkeit sei überhaupt ein Unding. Im Gegenteil: Nur durch argumentierende Vernünftigkeit ist das Unvernünftige in der historischen Vernunft aufzeigbar geworden.
[20] Herausgebernotiz der Werke Feuerbachs in: Ludwig Feuerbach, Sämtliche Werke, neu hrsg. von Wilhelm Rolin und Friedrich Jodl, Stuttgart 1903-1911, Band V, Pierre Bayle. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und der Menschheit, 11838.
[21] Sie wurden Freundinnen des Hofrats Leibniz, weil ihnen das prunkvolle Hofleben ihrer Gatten, die diesen Umgang der Damen nicht ernst nahmen, „unmoralisch“ dünkte; vgl. Chronik, passim.
[22] Selbstverständlich lässt sich auch der Autor dieses Werkes nur mit Verfälschungen als Reaktionär charakterisieren – um so katastrophaler für das Systematische der philosophischen Vernunft.
[23] Damit ist gemeint, man müsse auch in Erwägung ziehen, dass die Kritiker der rationalistisch-idealistischen Systeme gar nicht immer begriffen hätten, worum es sich bei den philosophischen Fragen handelte. Wer nichts zu verteidigen hat, kann gut das andere blind, abstrakt, hämisch und mit Ressentiment von sich schieben. Allerdings ist Vorsicht am Platz in betreff einer Bestimmung von Nichts und Etwas in einer kritischen Anstrengung. Wie oft lässt sich von der Sache her nur sagen, dass etwas falsch ist, ohne dass die Möglichkeit gegeben wäre, eine billige, angemessene Alternative widerspruchsfrei zu artikulieren.
[24] Bayle war ein Hugenotte aus Frankreich.
[25] Chronik 93: „Denn es ist nicht notwendig, dass man lebt sondern es ist notwendig, dass man arbeitet und seine Pflicht erfüllt“ (30. 12. 1688).
[26] Im Leibnizbuch Ludwig Feuerbachs, Sämtliche Werke, a. a. O., Band IV, Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibniz'schen Philosophie, ist p. 24 ein Brief von Leibniz an Hansch abgedruckt, der zeigt, wie dies im Rationalismus eben unmöglich ist: „Die mathematischen Wissenschaften aber, als welche von den ewigen, im göttlichen Geiste gegründeten Wahrheiten handeln, bereiten uns auf die Erkenntnis der Substanzen vor. Das Sinnliche aber, überhaupt das Zusammengesetzte, ist vergänglich; es wird vielmehr, als dass es ist und besteht.“ Leibniz vermochte nichts vom Trümmerhaufen Descartes' zur Seite zu räumen, geschweige denn das Zwiespältige in der Idee des philosophischen Systems auf längere Zeit hin mit Erfolg zu übertünchen.